Dienstag, 5. September 2023
Kunst im Sommer 2023: In Paris, Berlin, Hamburg, …
youjia, 11:32h
Paris

Fondation Louis Vuitton, Architektur von Frank Gehry, im Jardin d‘Acclimatation, Eröffnung: 2014.

Die Fondation Louis Vuitton zeigte Basquiat x Warhol: Painting Four Hands, 5.4.–28.8.2023. Ausgestellt wurden siebzig der insgesamt etwa 160 Bilder, die Jean-Michel Basquiat (1960–1988) und Andy Warhol (1928–1987) zwischen 1984 und 1985 zusammen gemalt hatten. Dazu waren gut ein Duzend Bilder der beiden in weiterer Kooperation mit Francesco Clemente (*1952) sowie von ein paar weiteren New Yorker Künstlern und einiger sehr weniger Künstlerinnen zu sehen. Das gesamte Gebäude war in elf Sektionen unterteilt bespielt. Ich mochte Basquiat vorher schon, vor allem seinen wilden Strich, aber erstmals den Originalen gegenüberstehend bespringt einen regelrecht eine sprühende Energie. Von Warhol haben mir insbesondere seine Zurücknahme und der Respekt in den Bildern und in gelegentlichen Aussagen gegenüber dem viel jüngeren Kollegen gefallen. Deshalb hier in aller Ausführlichkeit.
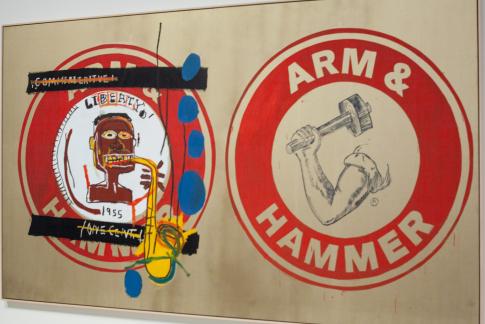
Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol: Arm and Hammer II. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
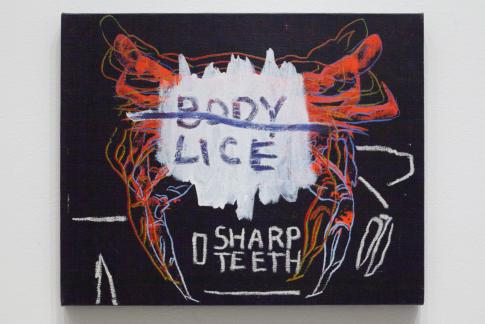
Basquiat and Warhol: Sharp Teeth. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection.

Basquiat, Warhol: Lobster. Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Lobster (White). Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
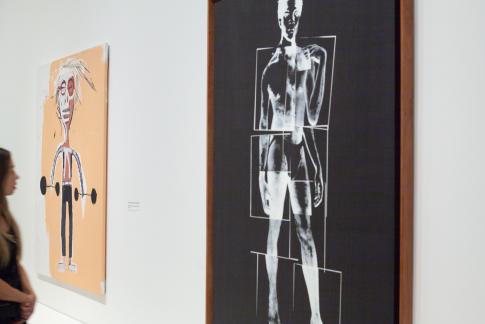
Links | Left: Basquiat: Untitled (Andy Warhol with Barbells). Acrylic and oilstick on canvas, ca. 1984. Private collection.
Rechts | Right: Warhol: Jean-Michel Basquiat. Acrylic and silkscreen ink on linen, 1984. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.
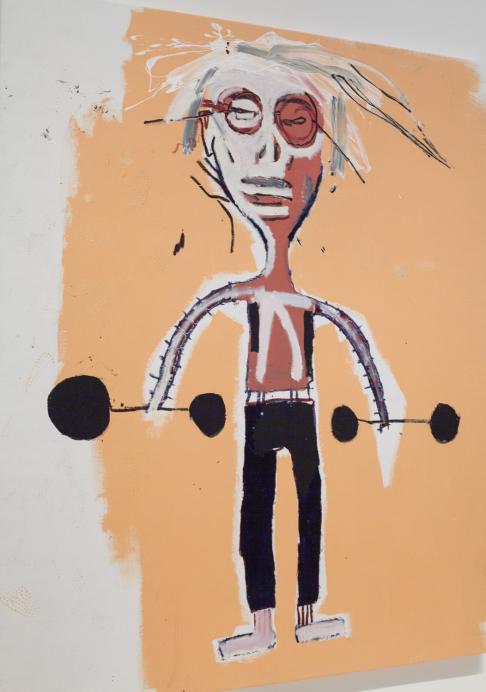
Ebd., links | left.
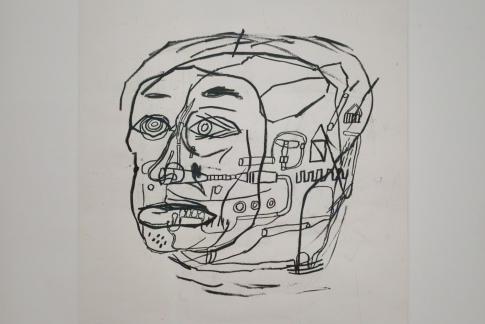
Basquiat: Untitled. Oilstick on paper, 1984. Private collection, London.

Warhol: Self-Portrait with Jean-Michel Basquiat. Polaroid, October 4, 1982. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: Dos Cabezas. Acrylic and oilstick on canvas with wood supports, 1982. Private collection, courtesy Gagosian.
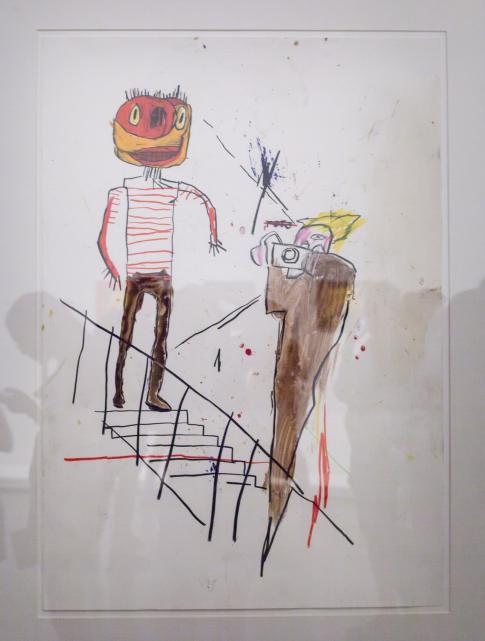
Basquiat: Foto (Jean-Michel Basquiat being photographed by Andy Warhol). Mixed media on paper, 1983. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
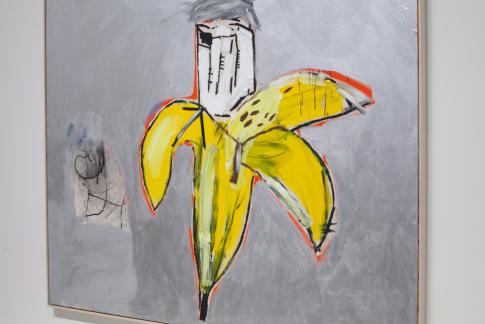
Basquiat: Brown Spots (Portrait of Andy Warhol as a banana). Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente and Andy Warhol: Alba‘s Breakfast. Mixed media on paper mounted on canvas, 1984. Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
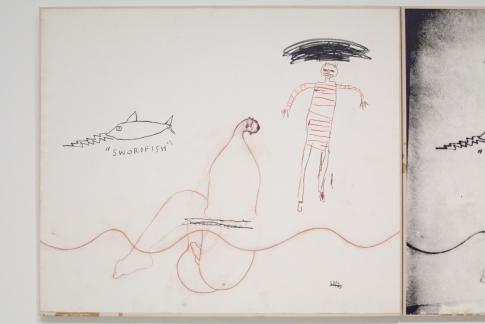
Basquiat, Clemente, Warhol: Tre Amici. Detail, coloured pencils on paper mounted on canvas and silkscreen ink on paper mounted on canvas, 1984. Disaphol Chansiri.
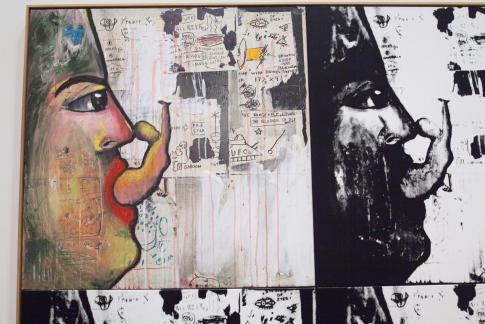
Basquiat, Clemente, Warhol: Pole Star. First panel: acrylic and collage on metal, 1984. Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
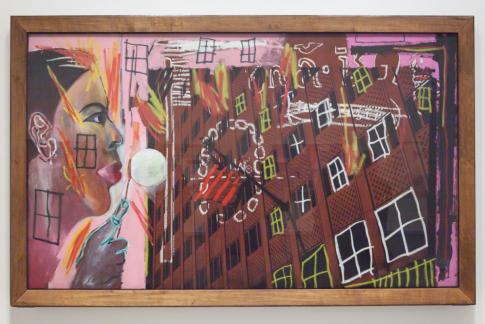
Basquiat, Clemente, Warhol: Premonition. Oilstick, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Hubert Burda Foundation.
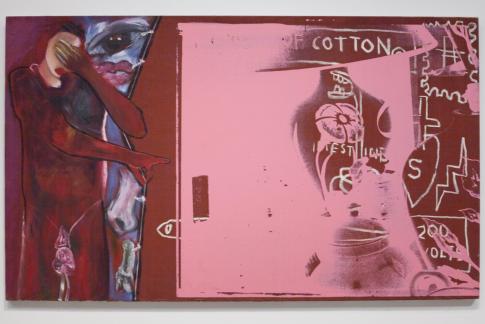
Basquiat, Clemente, Warhol: Casa del Popolo. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984. Private collection.
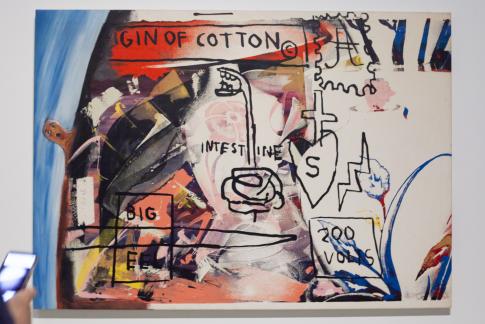
Basquiat, Clemente, Warhol: Pimple Head. Mixed media on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
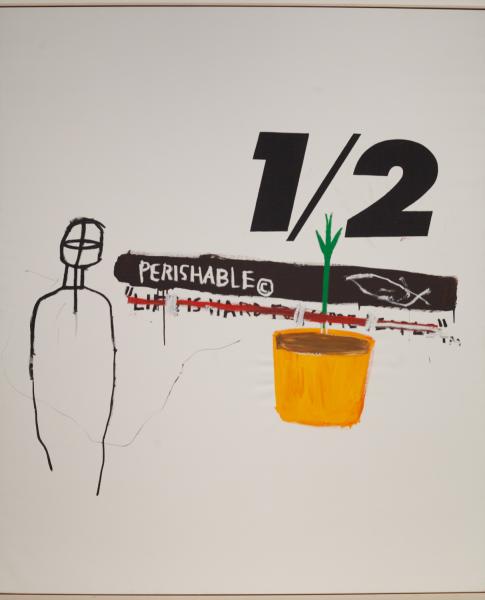
Basquiat, Warhol: Perishable. Acrylic and silkscree ink on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: 1/2 Keep Frozen. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Nahmad Contemporary, New York.

Basquiat, Warhol: Untitled (50 Dentures). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Collection Nicola Erni.

Basquiat, Warhol: China. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
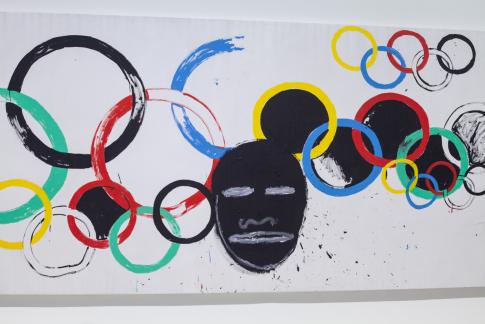
Basquiat, Warhol: Olympic Rings. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1985. Collection Éditions Enrico Navarra.
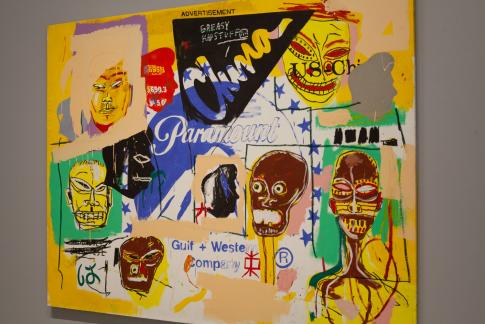
Basquiat, Warhol: China Paramount. Acrylic, oilstick and silkscreen ink on canvas, 1984. Collection Nick Rhodes.

Basquiat, Warhol: African Masks. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, ca. 1984. Private collection.

Basquiat, Warhol: Untitled (Two Dogs). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Private collection.
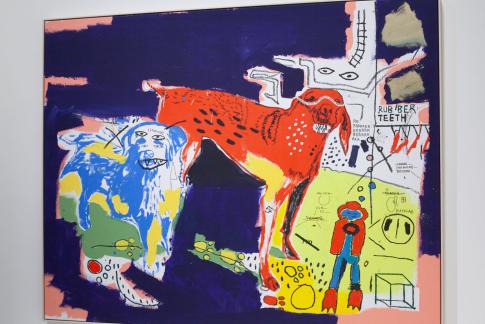
Basquiat, Warhol: Dogs. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Cabbage. Acrylic and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Highest Crossing. Acrylic on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Stoves. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: 45 Plates. Detail, Marker on ceramic, 1983–86.
Hier | Here: Robert Rauschenberg, Alfred Hitchcock, Cezanne, Louise Nevelson, Max Ernst and Henry Ford.

Ebd.
Hier | Here: Picasso, Frank Stella, Henri Matisse, Jasper Johns, Cy Twombly, Fab 5 Freddy.
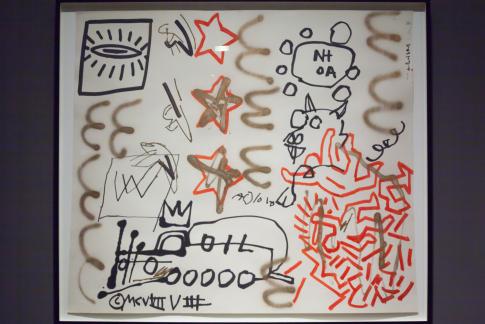
Jean-Michel Basquiat and Keith Haring: Untitled. Ink and gold spray paint on paper, 1981. Keith Haring Foundation.
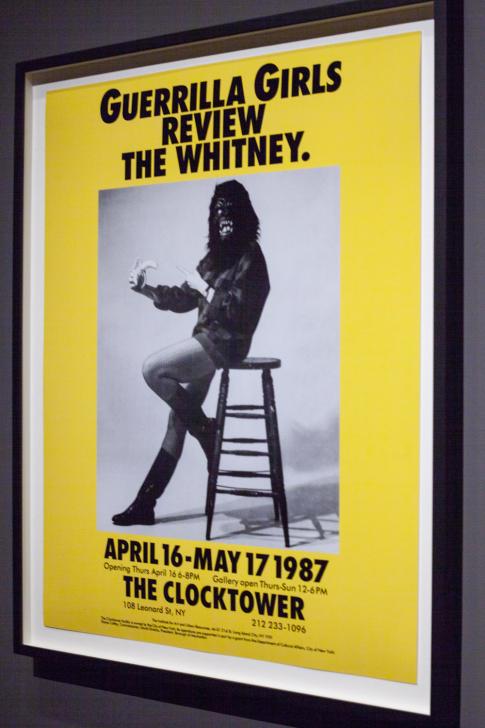
Guerrilla Girls Review the Whitney. 1987. Courtesy the Guerrilla Girls.

Keith Haring and LA II: Untitled (Female Bust). Ink and Day-Glo acrylic paint on fiberglass, 1983. Collection Larry Warsh.

Dean Chamberlain: Keith Haring, Nick Rhodes & Simon Le Bon on the Set Haring Painted for Arcadia‘s Appearance on MTV. Colour print, 1985. Collection Nick Rhodes.
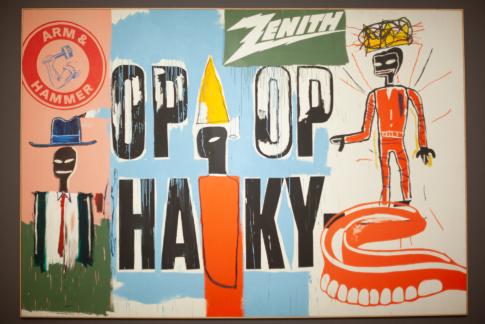
Basquiat, Warhol: Op Op. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
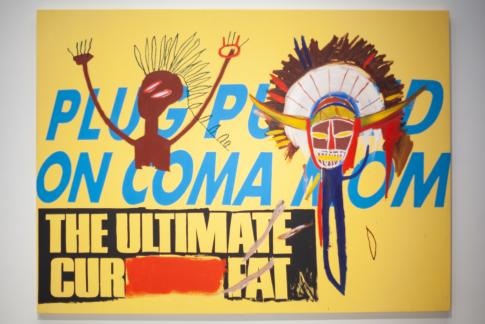
Basquiat, Warhol: Collaboration. Acrylic and oilstick on linen, 1984–85. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.

Basquiat, Warhol: Collaboration (Pontiac) No. 5. Detail, acrylic on canvas, 1984. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Basquiat: Gravestone. Acrylic and oil on wood panel, 1987. Private collection, courtesy Galerie Enrico Navarra.
Sorry, dass ich das Foto verschliert habe.

Katharina Grosse: Canyon. Detail, 14,5x5,7x9m, 3,7 tonnes, acrylic on aluminium, 2022.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.





Djan Silveberg: Téménos (τέμενος). Installation, building, technical and administrative equipment, furniture, staff, art production, visitors, 2022.
Google klärt Temenos auf als einen „abgegrenzten heiligen [Tempel]bezirk im altgriechischen Kult“. Online finde ich nichts in Verbindung zur Fondation, dafür aber ein paar ähnliche Bildtafeln auf Silvebergs Instagram, etwa von 2021 in Straßburg – ob er diese Tafeln heimlich als Interventionen anbringt?
--
Der Palais de Tokyo hatte geschlossen. Im benachbarten Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris (MAM) liefen nur die Sammlungsausstellungen, Sonderausstellungen öffnen erst wieder nach der Sommerpause.


Alfred Janniot. Detail.

Marcel Gaumont.


Kate Newby (*1979): The Edge of the Earth. Bricks, mortar, 2022.
Doch auch die Dauerausstellungen des MAM haben einiges zu bieten. Zunächst den „Salle Matisse“ mit seinen „Tänzen“ in der 2017 renovierten Galerie:

Henri Matisse (1869–1954): La Danse inachevée | The Unfinished Dance. Huile et fusain sur toile | Oil and charcoal on canvas, 1931. Achat Succession Pierre Matisse, 1993.

Ebd., Detail.

Henri Matisse: La Danse | The Dance. Huile sur toile | Oil on canvas, 1931–33. Achat à l‘artiste, 1936 sur le fonds d‘acquisition de l‘Exposition international de 1937.

Ebd. wurde die erste Version dieser Arbeit in der Barnes Foundation, Philadelphia unter Aufsicht von Matisse installiert, Foto aus Schaukasten.
Dann ging es zu den Schenkungen von Zao Wou-Ki 赵无极 (1920 oder 1921 in Beijing –2013 in Nyon). Zao zog 1947 nach Paris, wo er bis 2011 lebte, seit 1983 werden seine Arbeiten auch in China ausgestellt.

Zao Wou-Ki: I. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: I, 63. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: Six janvier 1968. Huile sur toile | Oil on canvas, 1968. Achat en 1971.

Ebd.: 01.10.73. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1973. Don de Mme Françoise Marquet-Zao en 2022.
Und nun in einem Sprint durch die hier präsentierte Moderne:

Otto Freundlich (1878–1943): Composition. Huile sur toile | Oil on canvas, 1911. Achat en 2014.

Bart van der Leck (1876–1958): Au marché. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Achat en 1991.

Auguste Herbin (1992–1960): Route muletière et maison à Céret. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Donation Henry-Thomas en 1976.

Pablo Curatella Manes (1891–1962): Le Guitariste. Bronze, 1921. Achat en 1962.

Francis Gruber (1912–1948): Les Malheurs de l‘amour. Huile sur toile | Oil on canvas, 1937. Don de M. François-Gérard Seligman en souvenir de Jacques Lassaigne en 2008.
Wenn schon keine Malerinnen ausgestellt werden, gibt es von mir wenigstens Frauenfiguren – obwohl sie namenlos und nur als Frauen „mit blauen Augen“, mit „rotem Hut“ benannt sind … oder schlicht als „Nackte“.

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme aux yeux bleus. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1918. Legs du Docteur Maurice Girardin en 1953.

Kees Van Dongen (1877–1968): Femme au chapeau rouge. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1925. Donation de Mme Mathilde Amos en 1955.
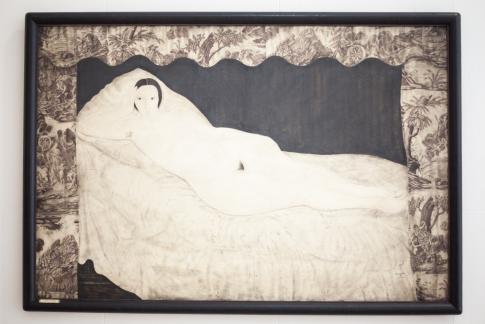
Léonard Foujita (1886–1968): Nu chouché à la toile de Jouy. Huile, encre, fusain et crayon sur toile | Oil, ink, charcoal and pencil on canvas, 1922. Don de l‘artiste en 1961.
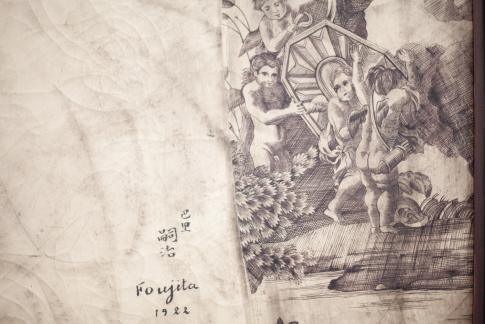
Ebd., Detail.

Gaston Lachaise (1882–1935): Floating Woman. Bronze, 1927 (fonte de 2015 | found 2015). Modern Art Foundry, New York, don de la Fondation Lachaise en 2019.

Jean Hélion (1904–1987): Figure bleue. Huile sur toile | Oil on canvas, 1935–36. Don de la Joseph Cantor Foundation, Indianapolis, en 1984.
In der Art Deco-Sektion sah ich dieses Zigarettenetui, das ich zu gern mein eigen nennen würde:

Paul Emile Brandt (1883–1952): Porte-cigarettes. Argent, or et laque | Silver, gold and lacquer, ca. 1937. Achat à l‘artiste en 1937.
An aktuelle(re)n Anschaffungen sind neben anderen folgende ausgestellt:
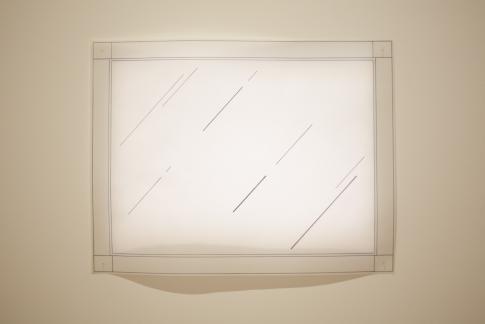
Marie Bourget (1952–2016): Reflet (Deuxième état). Encre sur calque | Ink on tracing paper, 1985. Don de Yves Bourget en 2021.

Pierre Weiss (*1950): panic room. #1, #2, #3, #4, #5. Aluminium, vernis, bois chêne, peinture acrylique | Aluminium, varnish, oak wood, acrylic paint, 1992–2022. Courtesy de l‘artiste et de la Galerie Valeria Cetraro.

Ebd., Detail.

Hubert Kiecol (*1950): Bundesbank. Detail, Béton | Concrete, 2010. Collection de l‘artiste.

Helmut Federle (*1944): Bird Migration at Azusa-Gawa River in Winter. Acrylique sur toile | Acrylic on canvas, 2022. Courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder.
--
Das Jeu de Paume, die Galerie nationale du Jeu de Paume, zeigt Frank Horvat: Paris, the World, Fashion, 26.6.–17.9.2023.

Prostitutes in a Police Car, Paris, for „Réalités“. Tirage argentique moderne | Modern silver-plate print, 1956.
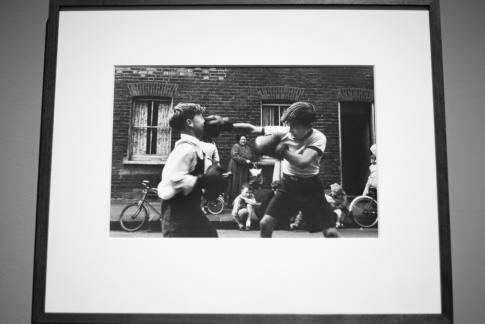
Chilrden Boxing, Lambeth, London, England. 1955. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

The Lido, Paris. 1956. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2002.
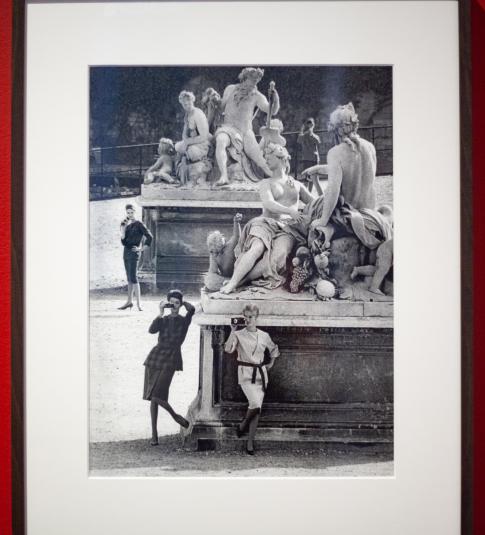
Place de la Concorde, Paris, for „Jardin des Modes“. Tirage lambda moderne | Modern lambda print, 1958.
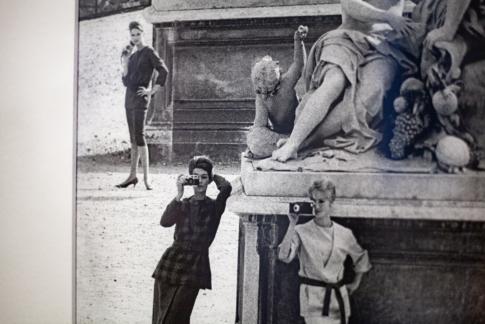
Ebd., Detail.

Judy Dent, for „Elegance“. Tirage argentique d‘époque | Vintage silver-plate print, 1962.

Woman and Shadow, New York, USA, for „Harper‘s Bazaar“. 1961. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.
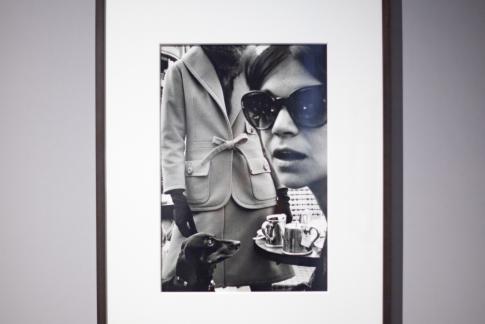
Carol Lobravico at the Café de Flore, Paris, French Haute Couture, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.
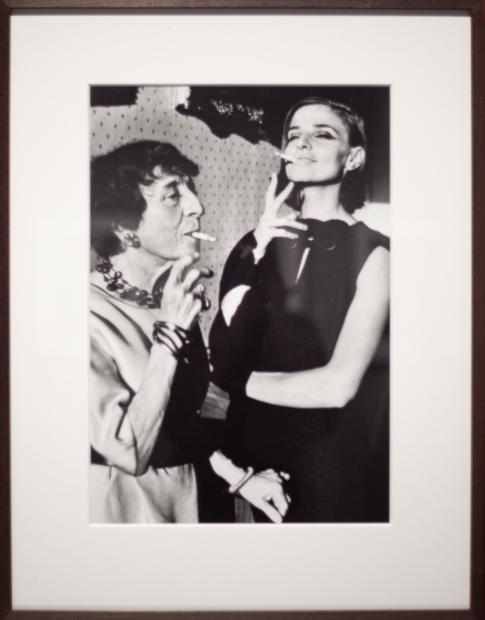
Iris Bianchi and Marie-Louise Bousquet, journalist, French Haute Couture, Paris, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

Television Studio with the Television Building in the Background, Cairo, Egypt. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1962.
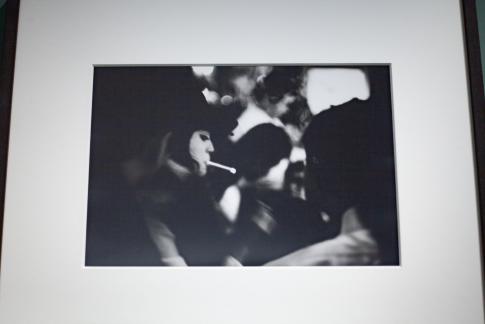
Soirée, Tokyo, Japan. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1963.
Und was für eine simple wie grandiose Idee, Einblick in die Schließfächer zu gewähren:
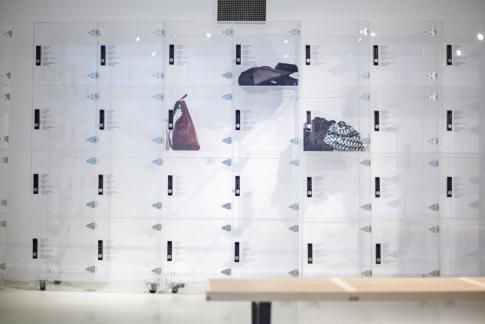
--
Direkt am anderen Eck des Parks kann man sich im Musée de l‘Orangerie Monets Wasserlilien ansehen, gemalt zwischen 1920–22, installiert 1927, die „Nymphéas“:

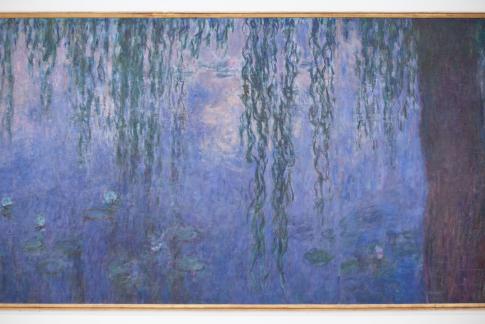
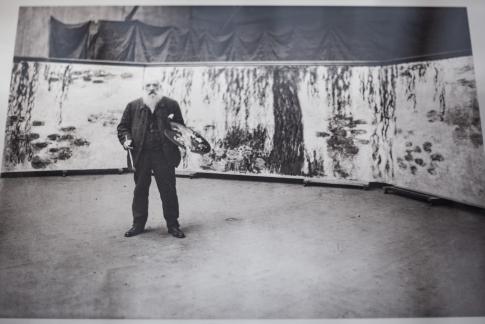
Henri Manuel (attributed): Claude Monet in the Studio of the „Grand Decorations“. Giverny, ca. 1920–22. Gift of M. Alfred Weil. Foto aus einem Schaukasten.
In den Kellergewölben der Orangerie mehr Moderne:

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme au ruban de velours. Huile sur papier collé sur carton | Oil on paper mounted on cardboard, ca. 1915.

Henri Matisse (1969–1954): Femmes au canapé ou Le Divan. Huile sur toile | Oil on canvas, 1921.
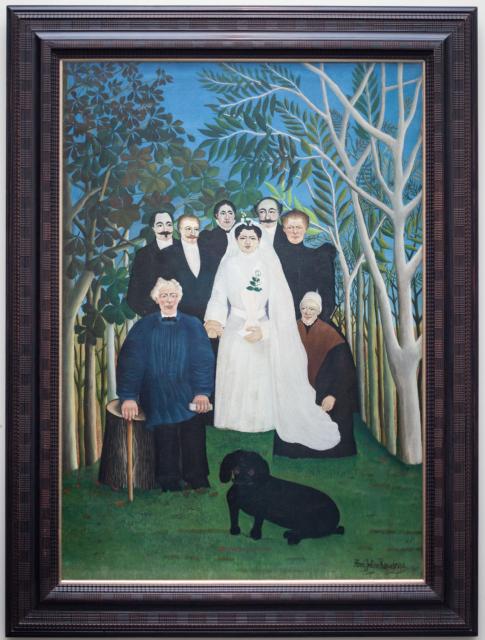
Henri Rousseau (1844–1910): La noce. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1905. Salons des Indépendants de 1905 et 1911.

Pierre-Auguste Renoir (1841–1919): Jeunes filles au piano. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1892.

Marie Laurencin (1883–1956): Les Biches. Huile sur toile | Oil on canvas, 1923.

André Derain (1880–1954): Arlequin et Pierrot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.

Maurice Utrillo (1883–1955): La Maison Bernot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.
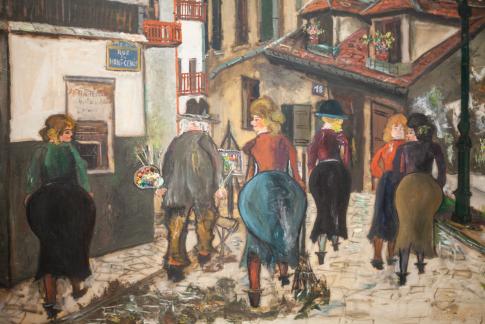
Ebd., Detail.

Pablo Picasso (1881–1973): Femme au tambourin. Huile sur toile | Oil on canvas, 1925.

Chaïm Soutine (1893–1943): La Jeune Anglaise. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1934.

Ders.: Paysage. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1922–23.
--

Zwischen den Parks Jardin de Tuilerier (dort: Jeu de Pleume und Orangerie) und Jardins des Champs-Élysées liegt der Place de la Concorde, der Platz der Eintracht. In seiner Mitte und in der Sichtachse vom Louvre zum Arc de Triomphe thront der 23,5m hohe Obélisque de Louxor, der Obelisk von Luxor, einem Geschenk von Ägyptens Vizekönig Muhammad Ali Pascha an Frankreichs König Louis Philippe I., aufgestellt 1836. Auf der Säule kann der komplizierte Transport nachvollzogen werden, auf einer technischen Infografik und wie das Obeliskenmützchen in Gold.
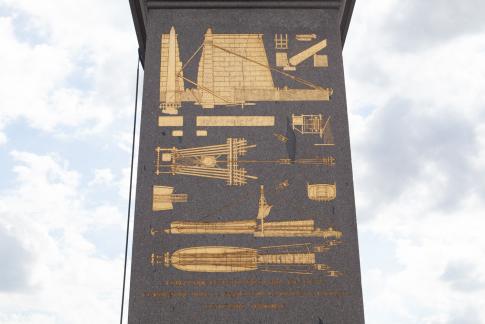
Unweit erinnert eine Steinplatte an den Platz der Revolution 1792–95 mit den Enthauptungen von Louis XVI. am 21.1.1793 und Marie-Antoinettes am 16.10.1793.

--

In der Lektüre von Frank Maier-Solks „Green Fields“ (s. u. in der Sommerlektüre) stieß ich auf den Garten des Friedens (Fountain de la Paix oder Japanischer Garten, Jardin Japonais) im UNESCO-Hauptquartier, Bauzeit: 1956–58, von Isamu Noguchi, Adresse: 7 Pl. de Fontenoy, 75007 Paris.
Auf der UNESCO-Seite fand ich nicht die Möglichkeit, nur den Garten besichtigen zu können, vielleicht muss man eine gesamte Tour buchen. Deshalb ging ich einfach vorbei und … stieß auf ein verwaistes Gelände. Immerhin aber mit einem Zaun, durch den man blicken und knipsen kann. Hier eine Beschreibung zum Garten von 1958, s. S. 32–34.



Dani Karavan: Square de la Tolérance en Hommage à Yitzhak Rabin. Don de l‘artiste et de l‘Etat d‘Israël, 1996.
Text in neun Sprachen, darunter: „Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.“, „战争起源于人之思想,故务需于人之思想中筑起保卫和屏障。“, „Constitution of the UNESCO“. Etwas dubios ist hier, dass die chinesische Version nicht wie die englische von einer „Verteidigung des Friedens“ spricht, sondern davon, dass „Schutz und Abschirmung errichtet werden“ müssten.



Finde den Eiffelturm.


--
In das Musée du Quai Branly, Adresse: 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris, wollte ich nicht hinein, aber das Gebäude aus Glas, bedeckt mit Pflanzen und Bäumen, sah online umwerfend aus. Also bin ich vorne in den Garten, durch den Park, am Gebäude vorbei, hinten wieder raus – kann ich eine falsche Seite erwischt haben oder war es irgendwann einmal faszinierend? Ich konnte mich leider nicht begeistern.
Auf dem Weg von hier nach dort findet man sich stets gern an der Seine wieder, zum Beispiel im Musée de la Sculpture en plein air, Adresse: 11 Bis Quai Saint-Bernard, 75005 Paris.

Jean Robert Ipoustéguy (1920–2006): L‘homme aux semelles devant [Der Mann mit den Sohlen vorne]. 1984. Hommage à Arthur Rimbaud (1854–91).

Ders.: Hydrorrhage. Bronze, 1975.

Ebd., andere Seite.

Antoine Poncet (1928–2022): Ochicagogo. Bronze, 1979.

Erwin Patkai (1937–85): Béton armé. Sculpture, 1973.
Auf der Suche nach ein wenig Gegenwart wurde das Musée Rodin von der Liste gestrichen.

Brückenpfeiler in der Form eines Raumschiffes mit Mutter und Kind als Spitze.


Allgemein schien die Stadt in Sommerflucht. Die Gegenwartskunst kam einem immerhin in Schnipseln und Stanzeln unter die Linse. Die Kunstviertel aber hatten geschlossen.

Geschlossen hatte der Startup-Campus mit Popup-Stores Station F, Adresse: La Halle Freyssinet, 5 Parv. Alan Turing, 75013 Paris.


Ebd., Food Market.
Ebenfalls geschlossen waren die Galerien in der benachbarten Rue Louise Weiss sowie das gesamte nördöstlich gelegene Kulturzentrum in der ehemaligen staatlichen Leichenhalle namens Le Centquatre, Adresse: 5 rue Curial, 75019 Paris – nächstes Mal. Als weitere Galerienviertel in der Stadt könne man, vermutlich außerhalb der Ferienzeit, ins Frac île-de-France, Adresse: 22 Rue des Alouettes, 75019 Paris, und Umgebung, sowie in das beim Centre Pompidou gelegene Areal Le Marais.

Die Fahrstuhlröhre am Centre Pompidou sollte man im Sommer wegen Überhitzung allerdings besser meiden. Eine tolle Aussicht hat man natürlich trotzdem.


Hier in der Nachbarschaft vom Pompidou.

Auch das nördlich gelegene Repair Café La REcyclerie, Adresse: 83 Bd. Ornano, 75018 Paris, wurde auf Sparflamme betrieben (vielen Dank für den Tipp an Andi).

Wenn man möchte, so findet man in den Gerüstkonstruktionen am Notre-Dame Gegenwartskunst. Gut gemacht sind dort auch die Infografiken, die einen durch den Wiederaufbau führen. Lass es dir gut ergehen, du wunderbares Gebäude.


Weiter durch die Gegend …

Finde die Touristen.

Finde den zweiten Eiffelturm in diesem Blogpost.

Entlang der Seine sieht man die eine oder andere Brücke mit den von mir sehr geliebten Groteskköpfen.

--

Was ein wundersam verwinkelter Durchgang, dachte ich, schoss dieses Bild und schlüpfte hinein. Aber, ach, ich falle immer wieder auf Eckchen dieser Art herein. Letztens erzählte mir jemand, dass nur Rüden ihr Revier markierten – als könnten Männer nichts dafür, es sei halt ihr Trieb? Google meint dazu, dass auch Hündinnen gelegentlich mitmachten, vor und während der Brunst und vor allem, wenn ein annehmbarer Rüpel in der Nähe weile. Man kann es sich also abgewöhnen. Werte Herren allerorts: Bitte zivilisiert euch endlich. Oder sollte man doch damit anfangen, Fotos von euch zu machen? An der Seine findet ihr in Abständen von einer halben Flasche Bier diese Auffänger:

Derweil in:
Berlin

Pride Parade vor der Neuen Nationalgalerie, 22.7.2023.
Isa Genzken: Rose IV. 8,25m, 646kg, Aluminium, 2016, aktualisiert | updated 2023.
Die Neue Nationalgalerie zeigt Isa Genzken: 75/75, 13.7.–27.11.2023. Anlässlich Genzkens 75. Geburtstag werden 75 ihrer Skulpturen aus allen ihren bisherigen Schaffensphasen ausgestellt. Die Show ist sehr zu empfehlen.

Ausstellungsansicht, Detail.

Weltempfänger. 160x215x40cm, concrete, steel, 1988–89. Private collection, London.

Data. 35x40x60cm, plaster, jute, wire, wood, 1984. Thomas Borgmann, Berlin.

Mein Gehirn. 24x20x18cm, plaster, metal, paint, 1984. Collection Daniel Buchholz and Christopher Müller, Cologne.

Institut. 68x27x14cm, plaster, paint, 1985. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Wega. 99x45x25cm, plaster, paint. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Untitled. Detail, 337x360x300cm, installation consisting of 7 parts (4 towers, 3 columns), mirror foil, glass, plastic flower, cigarette, tin foil, spray paint, plaster, acrylic, woven polypropylene, medication instructions, coloured tape, photographs, plastic bag, metal clips, magazine covers, newspaper, aluminium, paper, 2015. Courtesy Galerie Buchholz.

Im Vordergrund | In the front: Office Lighting. 174x310x75cm, fabric, metal, plastic, MDF, acrylic, tape, spray paint, polystyrene, colour print on paper, 2008. Courtesy Galerie Buchholz.

New Building for Berlin. 225x60x45cm, glass, epoxy resin, wood, 2005. Private collection, London.

Fenster. 540x300x100cm, epoxy resin, steel, 1992. Thomas Borgmann, Berlin.

Ebd., Detail.
--
Im Kupferstichkabinett läuft World Framed: Zeitgenössische Zeichenkunst der Sammlung Schering Stiftung, 7.7.–8.10.2023.

Morgan O‘Hara (*1941): Movement of the Hands of Flutist Roy Amotz Performing at the Kupferstichkabinett, Berlin, 13 September 2017. Aus der Serie | From the series: Live Transmissions. 3-teilig, Bleistift auf Papier | 3 parts, pencil on paper, 2017. 2018 erworben von der Künstlerin | 2018 acquired from the artist.

Jorinde Voigt (*1977): Deklination II (26 Standpunkte), Rotation doppelter akustischer Impuls[e] (N, O, S, W; horizontale Distanz, vertikale Distanz, Volume in %, Dauer in Sek., Loop, Rotationsrichtung, Rotationsgeschwindigkeit | Declination II (26 Positions), Rotation Double Acoustic Impulse (N, O, S, W; Horizontal Distance, Vertical Distance, Volume in %, Duration in Sec., Loop, Rotation Direction, Rotation Speed). Detail, Bleistift und Tinte auf Papier | Pencil and ink on paper, 2008. 2008 erworben im deutschen Kunsthandel | 2008 acquired on the German art market (Galerie Fahnemann, Berlin).
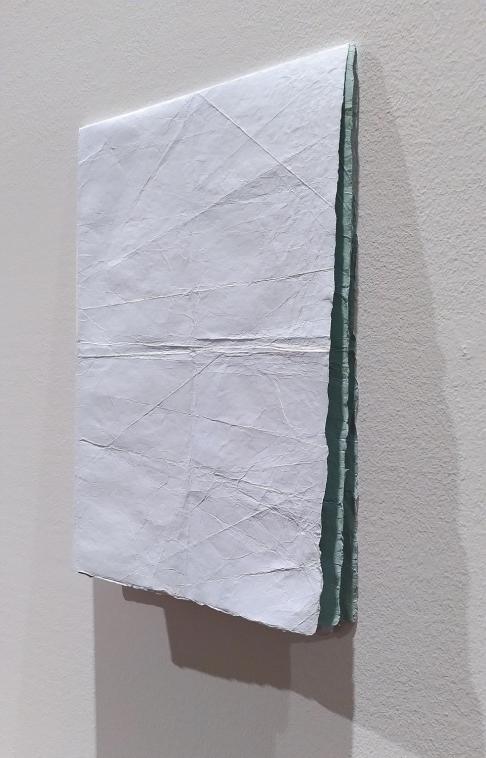
N. Dash (*1980): Aus der Serie | From the series: Commuter. Faltungen, Acryl auf Papier | Folds, acrylic on paper, 2021. 2022 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Mehdi Chouakri, Berlin).

Tom Chamberlain (*1973): Untitled. Nadelstiche in Papier | Pinpricks on paper, 2008. 2011 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Aurel Scheibler, Berlin).
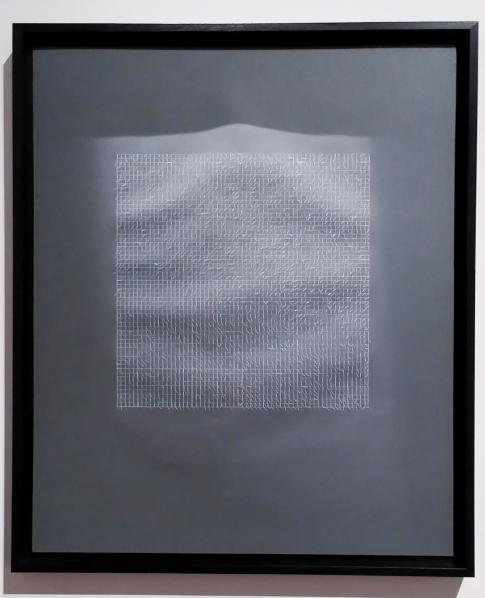
Fiene Scharp (*1984): Untitled. Weiße Haare, Tinte, Klebeband auf grauem Papier | White hair, ink, tape on gray paper, 2013. 2014 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (401 Contemporary, Berlin).
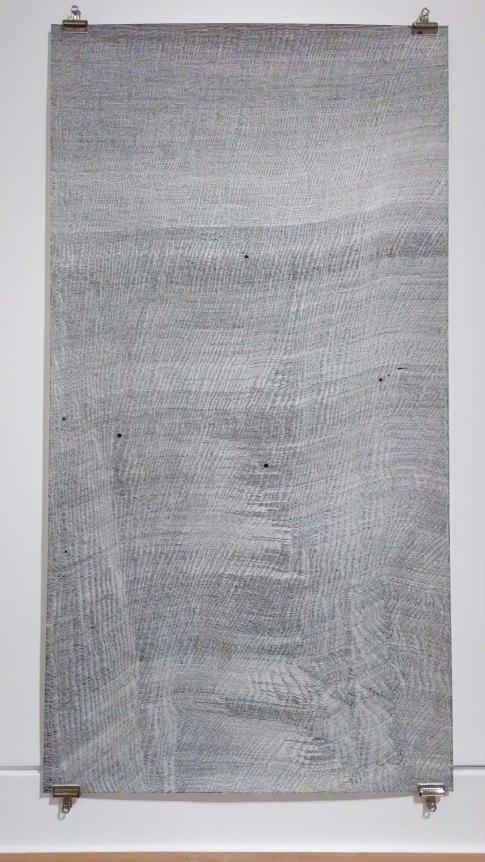
Sophie Tottie (*1964): Written Language (line drawings) XI. Pigmenttinte auf Papier | Pigment ink on paper, 2009. 2013 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Andrae Kaufmann, Berlin).
--
Frontviews zeigte Garden of Delete: Inflections, 7.7.–19.8.2023, im Haunt mit Kate Albrecht Fulton, Alice Dittmar, Delia Jürgens, Leon Manoloudakis, Marie Rief, Qiu Shihua und Dimitris Tampakis.
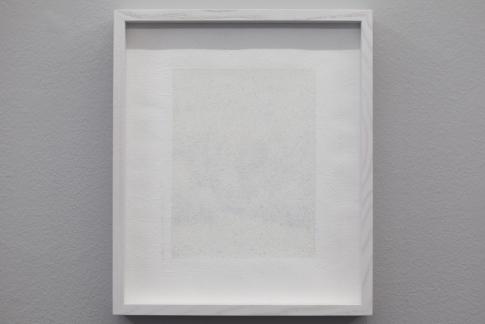
Qiu Shihua: Untitled. 30,5x23cm, watercolour and oil on paper, 2019.

Alice Dittmar: Shadowplay_screens I<>II. 185x95cm, ballpoint pen on photography, mounted on alu-dibond, 2021–22.

Dimitris Tampakis: Your CEO Is Probably a Psychopath. 340x10cm, aluminium, 2021.

Ebd., Frontperspektive.

N. K. Jain: Berlin Melodie. Wandgemälde im Innenhof des Haunt, beauftragt vom Bezirksamt Tiergarten, 1978.
--

Die Weißensee Kunsthochschule Berlin öffnete die Türen für ihren alljährlichen Rundgang, 22.–23.7.2023. Wir hörten uns den Vortrag von Wolfgang Ullrich an: Der Streit um die Autonomie der Kunst (hier vom 11.1.2023 an der Uni Köln). „Ich bin Kunstkritiker, nicht -produzent“, sagte er und stellte seine aktuelle Arbeitshypothese vor, das (gegenwärtige) Kunstverständnis in die zwei unterschiedlichen Typen von autonomer Kunst und postautonomer oder auch aktivistischer Kunst zu gruppieren.
Unabhängigkeit und Kunstfreiheit seien das Ideal seit der westlichen Moderne, ihr Sinn speise sich aus der Differenz von Werk und Publikum, dem damit eine Chance auf Veränderung, Kritik und Sensibilisierung vermittelt werde. Das Thema autonomer Kunst sei die Therapie, die Beschäftigung mit einem Kunstwerk werde zur Auseinandersetzung mit sich selbst, möglicherweise zu einem Bekehrungserlebnis. Hier herrsche eine klare Trennung zwischen Sender und Empfänger (Beispiel: Joseph Beuys). Diesem eher hermetischen und konfrontativ bis einschüchternden Ansatz entgegen fordere die postautonome Kunst aufgrund der aktuellen Weltlage eine klare Haltung. Ihr Thema sei die Identifikation. Hier gehe es um die Bestätigung zwischen Sender und Empfänger, dass man auf derselben Seite stehe, kooperiere. Man interagiere nicht, sondern repräsentiere, man unterwerfe nicht, sondern verstehe sich in Komplizenschaft (Beispiele: Zentrum für politische Schönheit, Tools for Action). Es gehe um Empowerment, anstatt „Du musst dein Leben ändern“ heiße es „Du lebst richtig, erfährst Unterstützung, um es leben zu können“. Anstelle der Verheißung von Erfahrung werden Augenhöhe geschätzt, ein Safe Space geschaffen, Inklusivität, die nicht ausschließen will. Das Konfliktpotential mit Institutionen, das Rechtsgut der Kunstfreiheit, die Mitbespielung des Marktes durch die Demokratisierung der Kunst, die Fragen um Cancel Culture, Propaganda, Kollektivität, Aktivismus je nach Sozialisierung, nach privilegierten Sonderrechten, unterschiedlicher Milieuzugehörigkeit führten zu einer Auseinandersetzung und Debatte um Positionen in der Gesellschaft. So richte sich die Störung von Kunstwerken in Museen der Letzten Generation – die Zukunft werde entscheiden, ob ihr Aktivismus als Kunstaktionen verstanden werde – gegen die ungestörte Rezeption von eben jenen Kunstwerken, gegen die therapeutische Kontemplation. Der Dialog zur Besserung solle gestört werden, weil das unschuldige Auge nicht mehr möglich sei. Vorher erschienen Frieden, Wohlstand, Freiheit möglich, die Motivation sei vorhanden gewesen, jetzt heiße es, Kräfte zu sammeln.
Aktuell befänden wir uns zwischen beiden Phänomenen. Dass Ullrich die beiden Typen nicht als dualistisches Entweder-oder sieht, sondern als Versuch einer neuen Begriffsbestimmung, nicht schematisch, sondern in Nuancen, muss er in der abschließenden Fragerunde erneut klarstellen. Natürlich habe es auch vorher partizipative Formate gegeben, aber die Grenzziehung zwischen der Kunstwelt und den anderen, den Profis und Amateuren, sei aufgeweicht.
Mehr dazu in Wolfgang Ullrich (2022): Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Berlin: Wagenbach.
--
Ohne sich zeitlich festlegen und einen Supersparpreis ergattern zu müssen, kann man anstatt mit dem ICE von Hamburg nach Berlin in 1:45 Stunden auch gut in insgesamt vier Stunden mit dem Regionalzug etwa über Schwerin fahren. Leider steckt das Staatliche Museum Schwerin bis voraussichtlich Herbst 2024 in Umbaumaßnahmen, aber der Burggarten beim Schloss ist sehr schön.

Schweriner Schloss.
Hamburg
Der Kottwitzkeller von Wolfgang Scholz und Dieter Tretow in der Kottwitzstraße 10 nahe Hoheluftbrücke in Eimsbüttel fand erstmals 1996 statt. Die jährlichen Ausstellungen wuchsen im Laufe der Zeit aus den Kellerräumen heraus zu einem Kunstfest in die gesamte Straße hinein, in die anliegenden Keller, Hinterhöfe und Wohnungen. Dem ersten Thema „Licht“ folgte nun das letzte: „Licht aus“, 26.–27.8.2023.

O. A.

O. A.
Vor diesem Guckloch wurde ein Licht aktiviert, wenn man sich in der dafür richtigen Position befand.
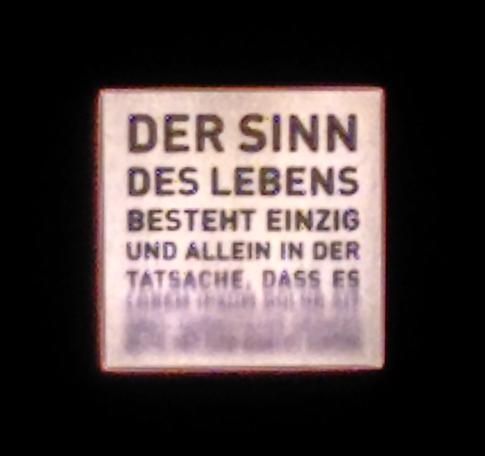
Ebd., Detail, Text: „Der Sinn des Lebens besteht einzig und allein in der Tatsache, dass es …“
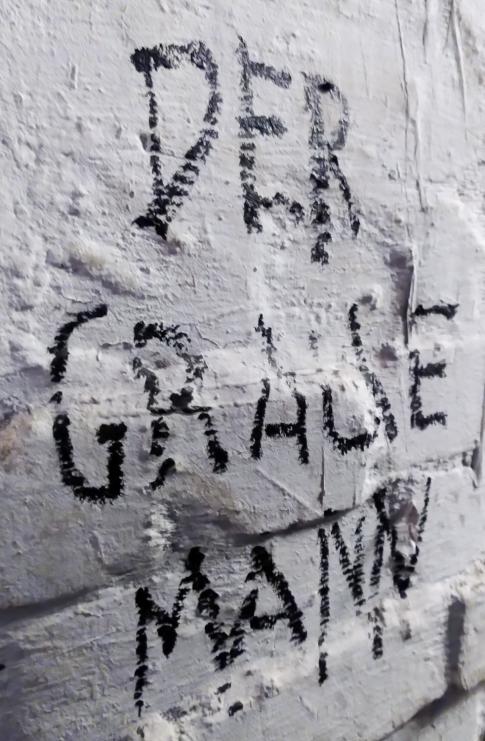
O. A., Text: „Der graue Mann“.
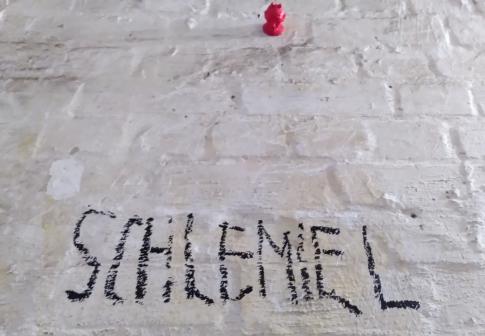
O. A., Text: „Schlemiel“.
Das Wort musste ich googeln, es ist jiddisch für einen Pechvogel oder Narren.

Gipsabdruck von Michael Dankers: Mißbrauchte Landschaft.
Koffer von Wolfgang Scholz, der im gesamten Gewölbe sieben Koffer mit Erinnerungen und/oder neuen Zusammenstellungen aufgestellte.
Text an der Wand rechts, O. A.: „Keine Macht für niemand“.

Luise Czerwonatis: „…, die Maschine steht still.“

Oliver Kunst: Wort im Dunkeln. Audioinstallation, Text: „Tatort V / III“.

Ulla Penselin: Der KottwitzKeller hatte viele Gesichter.
Bei dem schwarzen Ensemble handelt es sich um den Grundriss und damit Lageplan des Kellers.

Tanja Soler Zang: Kontakt. Detail, Raum-Klang-Installation.
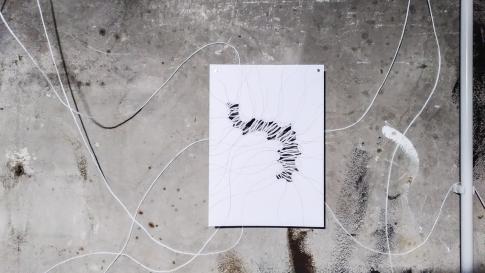
Ebd., Detail.
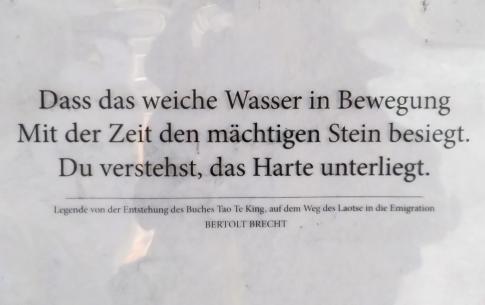
O. A.
Selbst China war präsent, auf diesem Schild und mit dem Text: „Dass das weiche Wasser in Bewegung / Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. / Du verstehst, das Harte unterliegt. // Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King, auf dem Weg des Laotse in die Emigration / Bertolt Brecht“.
--
Anlässlich all des Trubels um die Köhlbrandbrücke (s. jüngst etwa die Hamburg-Ausgabe der Zeit, Nr. 37) machte ich Anfang August eine kleine Fahrradtour zur 1974 fertiggestellten sogenannten Schrägseilkonstruktion des Architekten Egon Jux.

Wikipedia erklärt, der Brückenzug soll ingesamt 3618m lang sein – mit der östlichen Rampe von 2050m, 520m Elbüberquerung und 1048m westlicher Rampe. Als „lichte Höhe“ wird das Maß vom Untergrund bis zur Unterkante eines Tragwerks bezeichnet: hier 53m bei mittlerem Wasserstand; spannender finde ich die Höhe der beiden Pylone: knapp hundert Meter (135m inklusive der 37m hohen Stahlbetonpfeiler).


Mit der Fähre kommt man direkt von der Ost- auf die Westseite über den Köhlbrand, von Neuhof nach Waltershof. Nächstes Jahr muss ich unbedingt an der Fahrradsternfahrt teilnehmen, bei der in Hamburg eine Route über die Brücke führt.

Lübeck

Eine Reise nach Lübeck lohnt sich neben dem Streunern durch die mittelalterlichen Gänge der Altstadt immer wieder.
Vom Museum Behnhaus Drägerhaus läuft in der Kunsthalle St. Annen Mehr Licht: Die Befreiung der Natur, 12.7.–15.10.2023.

Andreas Aschenbach (1815–1910): Wasserstudie, Travemünde | Water Study, Travemünde. Öl auf Leinwand | Oil on canvas, 1835. Privatsammlung | Private collection.

Eduard Wilhelm Pose (1812–78, zugeschrieben | attributed): Waldbach | Forest Stream. Öl auf Leinwand auf Holz | Oil on canvas on wood, 1831. Privatsammlung | Private collection.
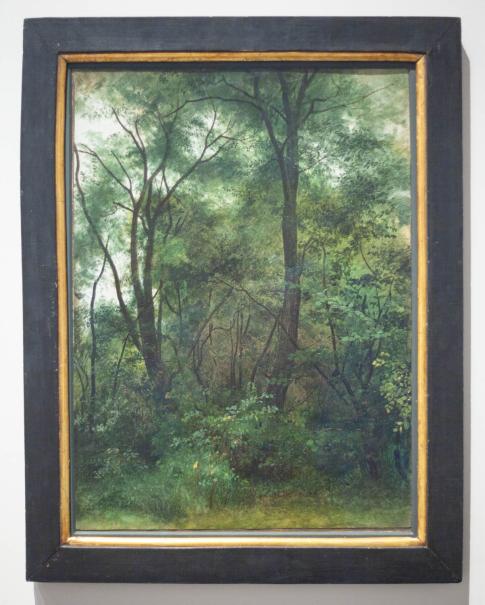
Christian Friedrich Gille (1805–99): Waldstudie | Forest Study. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, ca. 1840. Privatsammlung | Private collection.

Rosa Bonheur (1822–99): Landschaft im Nebel | Landscape in the Fog. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, undatiert | undated. Privatsammlung | Private collection.

Maximilian Hauschild (1810–95): Blick aus dem Fenster mit Weinreben | View from the Window with Grapevines. Öl auf Papier | Oil on paper, undatiert | undated. Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris.

Arnold Böcklin (1827–1901): Sonnenbeschienene, von Vegetation überwucherte Felswand in den Aequerbergen östlich von Rom | Sunlit Rock Face Overgrown with Vegetation in the Aequera Mountains East of Rome. Öl auf Leinwand, doubliert | Oil on canvas, doubled, ca. 1850. Privatsammlung | Private collection.
--
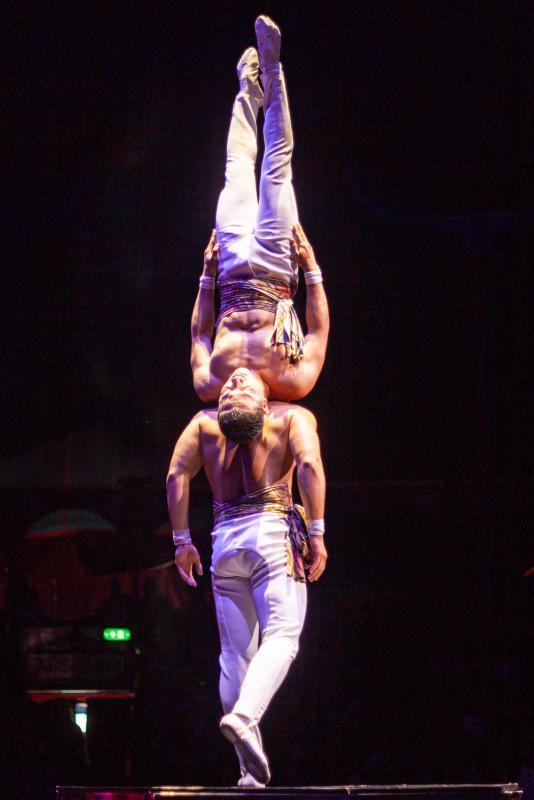
Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, kommt man seit Ewigkeiten einmal wieder in einen Zirkus. Roncalli gastierte im August in Lübeck neben dem Holstentor.
Sommerlektüre
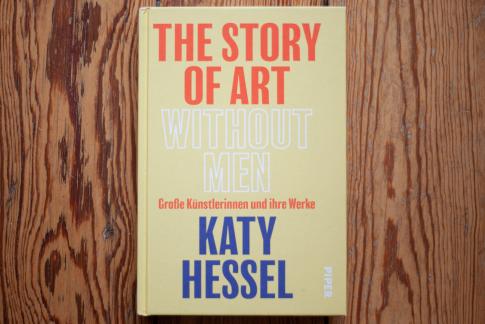
Katy Hessel (2022): The Story of Art without Men: Große Künstlerinnen und ihre Werke. Übs.: Marlene Fleißig, Astrid Gravert, Gabriele Würdinger und Maria Zettner. München: Piper.
Im Format von und in Anlehnung an Gombrichs „Die Geschichte der Kunst“ (The Story of Art), der „Bibel“, dem „Standardwerk“ der Kunsthistorik, erstmals 1950, bis 1996 in 16. Auflage erschienen, bricht Hessel in ihrer Parallelgeschichte „ohne Männer“ die westliche männliche Kunstgeschichtserzählung auf. In Gombrichs Kanon käme nur eine einzige Frau vor – ich habe sie auf die Schnelle nicht gefunden –, bei Hessel treten Männer nur am Rande und meist unrühmlich auf. Es handelt sich nicht um eine Abrechnung, sondern veranschaulicht, dass Frauen immer schon, allen Widerständen zum Trotz künstlerisch tätig waren. Gut, Gombrich beginnt in der Urzeit, Hessel um 1500, und auch wenn Hessel versucht, die nicht-westliche Welt miteinzubeziehen, so bleibt auch sie vermehrt in diesem Kosmos.
Doch gibt es großartige Persönlichkeiten zu entdecken, bekannte und noch viele, viele unbekannte, von Maria Sibylla Merian (habe mir gleich ihr Insektenbuch besorgt), Mary Cassatt, Leonor Fini, Gluck, Atsuko Tanaka, Alina Szapocznikow, Doris Salcedo bis Flora Yukhnovich. Interessant finde ich den möglichen Zufall, dass zwei Ausstellungen im Hamburger Bucerius Kunst Forum nach Erscheinen von Hessels Buch von ihr aufgenommene Exponate zu deren Titelbildern machten, das von Gabriele Münter (S. 133) und das von Lee Miller (S. 212).
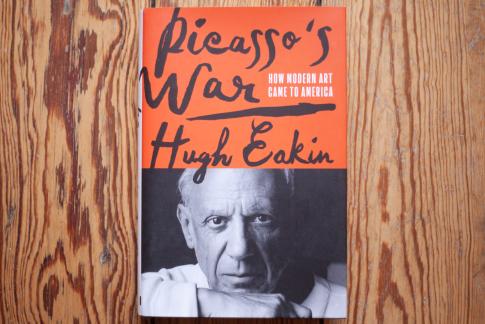
Hugh Eakin (2022): Picasso‘s War: How Modern Art Came to America. New York: Crown.
Auf dieses Buch stieß ich durch eine Podcastfolge von Dialogues, in der Helen Molesworth anlässlich des 50. Jahrestages von Picassos Tod (8.4.1973) mit Hugh Eakin spricht, vom 12.4.2023, 38 Min., Stand: 5.9.2023. Die Amis sind fabelhaft darin, wissenschaftliche Fakten mit Erzählkunst zu verbinden, so liest sich auch dieser Schinken wie ein Roman (und ist weitaus besser als die Podcastfolge). Anhand einflussreicher und visionärer Kunstmäzen·innen wird der über Jahrzehnte gescheiterte Versuch und endlich erfolgreiche Durchbruch beschrieben, Picasso und die moderne Kunst dem amerikanischen Publikum näherzubringen. Eakin geht dabei nicht zimperlich mit der größtenteils konservativen US-Bevölkerung um, er durchstreift die Zeit von der später als legendär bezeichneten Armory Show 1913 in New York bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dafür spürt er insbesondere den Lebenswegen von John Quinn (1870–1924), Jeanne Robert Foster (1879–1970), Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), Paul Rosenberg (1881–1959) und Alfred H. Barr Jr. (1902–81) nach.
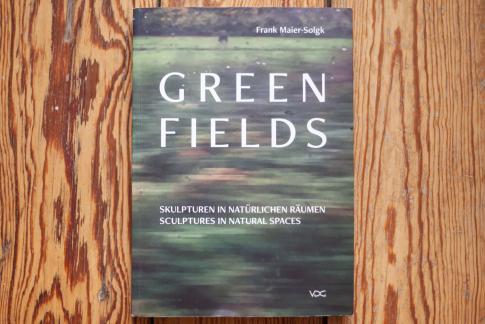
Frank Maier-Solk (2023): Green Fields: Skulpturen in natürlichen Räumen | Sculptures in Natural Spaces. Ilmtal-Weinstraße: VDG.
Frank Maier-Solk sieht den offenen Raum im „Green Field“ als Alternative zu Brian O‘Dohertys erstmals 1976 beschriebenem „White Cube“, dem modernen Ausstellungsraum in hermetisch abgeriegelter Sterilität – als neuerliche Platzierung der Kunst an einem bestimmten Ort, der eine eigene, externe Dramaturgie mit sich bringt. Maier-Solk beginnt seine Beschreibung in der westlichen Nachkriegszeit, in der Parks zu den ersten Ausstellungsorten wurden, weil Kriegsschäden dort schneller beseitigt werden konnten. Darüber hinaus aber hätten öffentlich zugängliche Anlagen auch den neuen Werten der Völkerverständigung entsprochen und als Ausdruck für Demokratie und Humanismus gegolten (ab S. 45).
Nach Exkursen über die amerikanische Land Art der 1960er und -70er Jahre werden „Grüne Felder“ in der Stadt dargestellt, etwa die Skulptur Projekte Münster und Entwicklungen auf der documenta, sowie „Grüne Felder“ auf dem Lande, etwa Refugien wie die in Ganslberg bei Landshut oder eigene Anlagen wie die von Niki de Saint Phalle in der Provence. Als neuere Phänomene skizziert Maier-Solk „Anthropozän-Kunst“, „Ökologische Kunst“ und „Revier-Landschaften“ (ab S. 179) sowie die „auffallend große Zahl neuer privater Skulpturenparks“ der letzten Jahre (S. 10) als ein „Natur-Revival“ (S. 13). Er beschreibt den Garten zum einen weiterhin als Sehnsuchtsort und Domestizierung der Natur und zeigt auf, wie das zunehmende Umwelt- und Naturbewusstsein zu einer „zusätzlichen Renaissance einer Kunst unter freiem Himmel geführt“ habe (Klappentext).
Maier-Solk brachte mich auf den Besuch von Isamu Noguchis „Garten des Friedens“ (Fountain de la Paix, Bauzeit: 1956–58) im UNESO-Hauptquartier in Paris (S. 64–66, s. für Bilder oben). Besonders hat mich auch gefreut, dem Engadiner Künstler Not Vital, den ich von Urs Meile aus Beijing kannte, hier zu begegnen (S. 248–52).
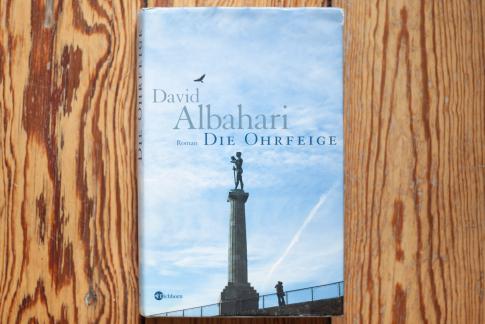
David Albahari (2007): Die Ohrfeige (Original: Pijavice). Übs.: Mirjana und Klaus Wittmann. Frankfurt a. M.: Eichborn.
Diesen wunderbaren Roman las ich auf die Empfehlung aus dem Nachruf von Alida Bremer: Zum Tod einer wichtigen serbischen Stimme, in: Fazit, DLF, 31.7.2023, 11:14 Min., Stand: 5.9.2023. Laut Bremer sollte es in diesem Werk von David Albahari (1948–2023) um Zweifel gehen, vor allem um Selbstzweifel der eigenen Wahrnehmung. Wer kann da widerstehen? Hier wird man noch dazu mit einer grandiosen Sprache, mit in Schalk verpackten Weisheiten und skurrilen Wendungen beschenkt.
Der namenlose Ich-Erzähler schreibt aus einem unbenannten Exil, in das er wegen der ihm widerfahrenen und in der serbischen Gesellschaft und Politik immer nur in Nebensätzen angedeuteten Ereignisse fliehen musste. Es geht um einen jüdisch-kabbalistischen Verschwörungsmythos, der auf antisemitische Nationalschergen trifft und Ende der 1990er Jahre im Belgrader Stadtbezirk Zemun spielt. Der Protagonist beobachtet am Ufer der Donau, wie ein junger Mann einer jungen Frau die titelgebende Ohrfeige verpasst. Durch diese Geste wird unser zweifelhafter Held, im Gegensatz zu Albahari kein Jude, in den Strudel der Vertreibung der jugoslawischen Juden und Jüdinnen gezogen. In seinem Bann begibt er sich auf die Suche nach Antworten, auf die er kaum die Fragen kennt. Bald sieht er in allem möglichen „einen Köder, der mich noch tiefer in eine Geschichte hineinziehen sollte, die ich im Grunde selbst konstruiert hatte“ (S. 304). Die fehlenden Absätze und der häufige Konjunktiv unterstreichen die Gemengelage zwischen Wahn und Wirklichkeit, Paranoia und echter Gefahr.
Tags für diesen Beitrag 这篇文章的标签: Unterwegs 路上, Ausstellung 展览, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bildende Kunst 美术, Hamburg 汉堡, Bücher 书籍


Fondation Louis Vuitton, Architektur von Frank Gehry, im Jardin d‘Acclimatation, Eröffnung: 2014.

Die Fondation Louis Vuitton zeigte Basquiat x Warhol: Painting Four Hands, 5.4.–28.8.2023. Ausgestellt wurden siebzig der insgesamt etwa 160 Bilder, die Jean-Michel Basquiat (1960–1988) und Andy Warhol (1928–1987) zwischen 1984 und 1985 zusammen gemalt hatten. Dazu waren gut ein Duzend Bilder der beiden in weiterer Kooperation mit Francesco Clemente (*1952) sowie von ein paar weiteren New Yorker Künstlern und einiger sehr weniger Künstlerinnen zu sehen. Das gesamte Gebäude war in elf Sektionen unterteilt bespielt. Ich mochte Basquiat vorher schon, vor allem seinen wilden Strich, aber erstmals den Originalen gegenüberstehend bespringt einen regelrecht eine sprühende Energie. Von Warhol haben mir insbesondere seine Zurücknahme und der Respekt in den Bildern und in gelegentlichen Aussagen gegenüber dem viel jüngeren Kollegen gefallen. Deshalb hier in aller Ausführlichkeit.
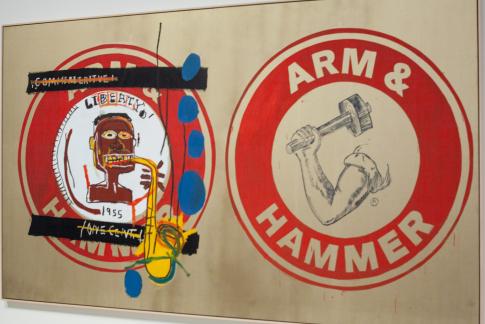
Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol: Arm and Hammer II. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
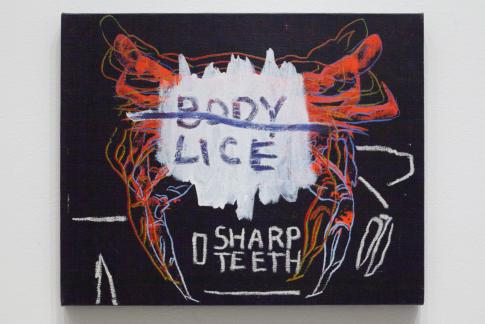
Basquiat and Warhol: Sharp Teeth. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection.

Basquiat, Warhol: Lobster. Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Lobster (White). Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
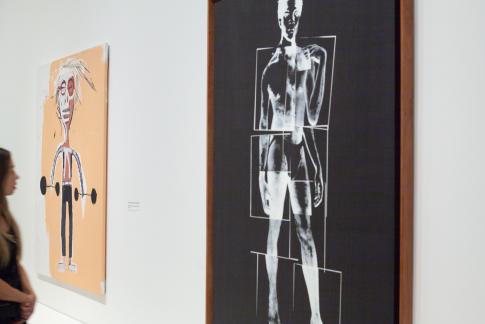
Links | Left: Basquiat: Untitled (Andy Warhol with Barbells). Acrylic and oilstick on canvas, ca. 1984. Private collection.
Rechts | Right: Warhol: Jean-Michel Basquiat. Acrylic and silkscreen ink on linen, 1984. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.
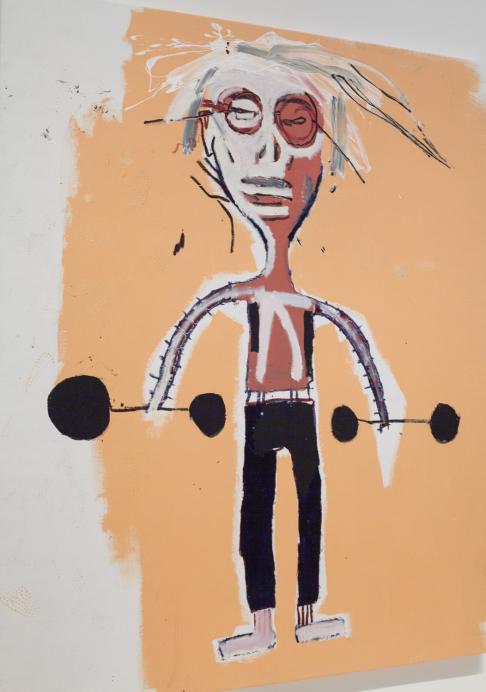
Ebd., links | left.
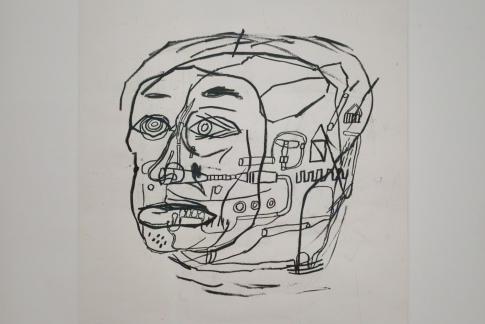
Basquiat: Untitled. Oilstick on paper, 1984. Private collection, London.

Warhol: Self-Portrait with Jean-Michel Basquiat. Polaroid, October 4, 1982. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: Dos Cabezas. Acrylic and oilstick on canvas with wood supports, 1982. Private collection, courtesy Gagosian.
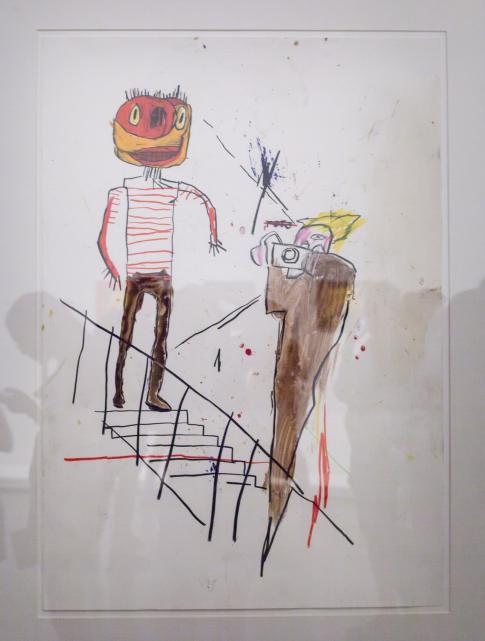
Basquiat: Foto (Jean-Michel Basquiat being photographed by Andy Warhol). Mixed media on paper, 1983. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
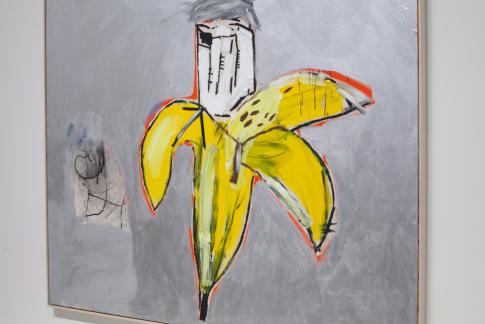
Basquiat: Brown Spots (Portrait of Andy Warhol as a banana). Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente and Andy Warhol: Alba‘s Breakfast. Mixed media on paper mounted on canvas, 1984. Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
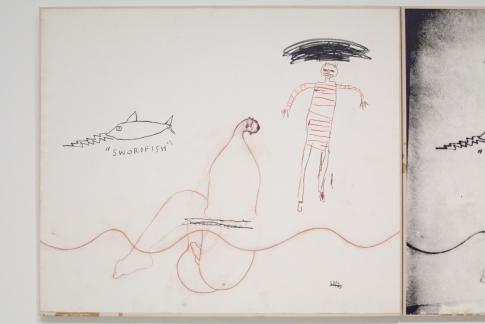
Basquiat, Clemente, Warhol: Tre Amici. Detail, coloured pencils on paper mounted on canvas and silkscreen ink on paper mounted on canvas, 1984. Disaphol Chansiri.
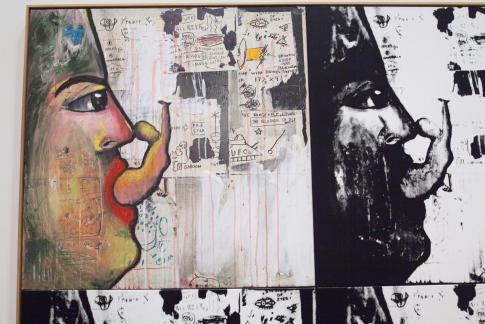
Basquiat, Clemente, Warhol: Pole Star. First panel: acrylic and collage on metal, 1984. Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
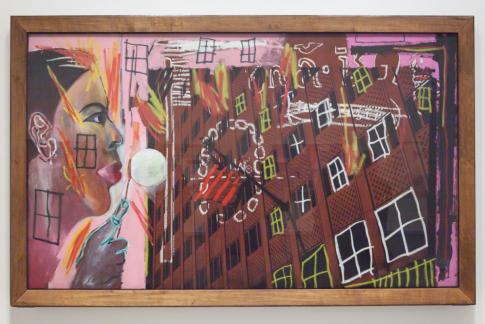
Basquiat, Clemente, Warhol: Premonition. Oilstick, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Hubert Burda Foundation.
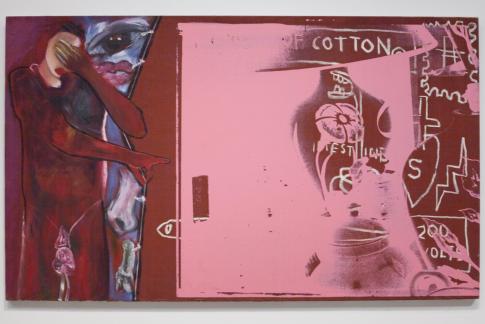
Basquiat, Clemente, Warhol: Casa del Popolo. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984. Private collection.
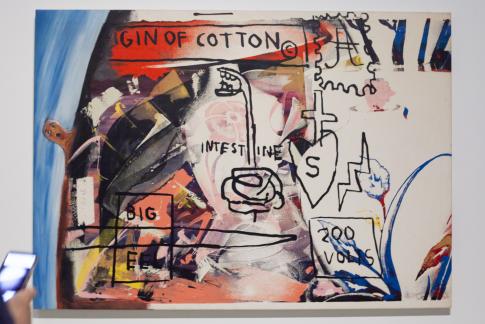
Basquiat, Clemente, Warhol: Pimple Head. Mixed media on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
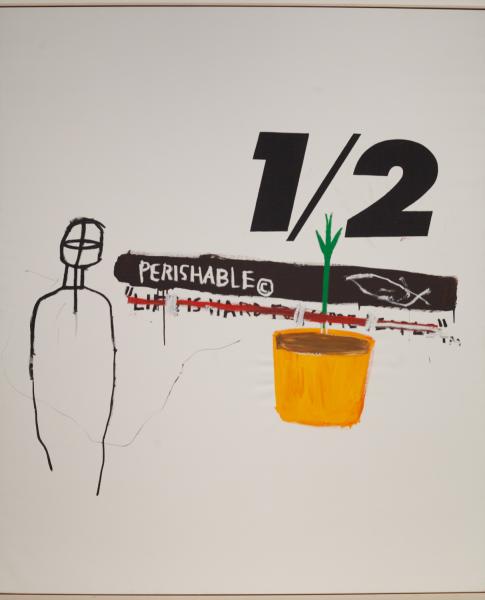
Basquiat, Warhol: Perishable. Acrylic and silkscree ink on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: 1/2 Keep Frozen. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Nahmad Contemporary, New York.

Basquiat, Warhol: Untitled (50 Dentures). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Collection Nicola Erni.

Basquiat, Warhol: China. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
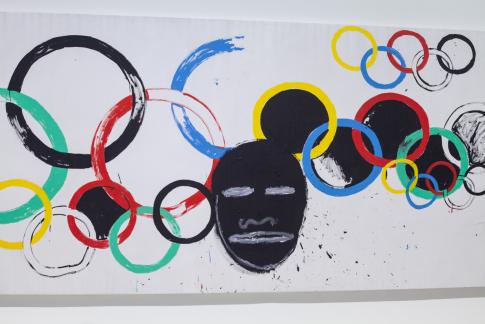
Basquiat, Warhol: Olympic Rings. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1985. Collection Éditions Enrico Navarra.
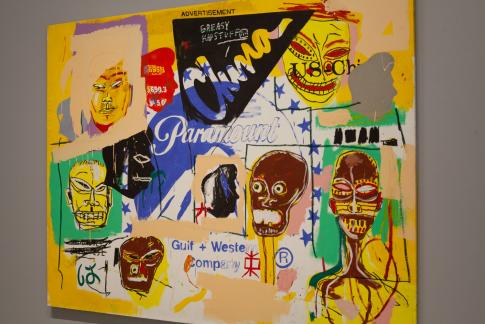
Basquiat, Warhol: China Paramount. Acrylic, oilstick and silkscreen ink on canvas, 1984. Collection Nick Rhodes.

Basquiat, Warhol: African Masks. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, ca. 1984. Private collection.

Basquiat, Warhol: Untitled (Two Dogs). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Private collection.
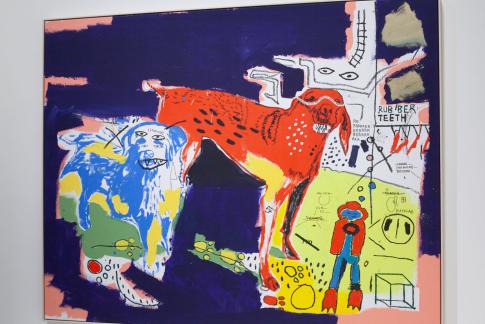
Basquiat, Warhol: Dogs. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Cabbage. Acrylic and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Highest Crossing. Acrylic on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Stoves. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: 45 Plates. Detail, Marker on ceramic, 1983–86.
Hier | Here: Robert Rauschenberg, Alfred Hitchcock, Cezanne, Louise Nevelson, Max Ernst and Henry Ford.

Ebd.
Hier | Here: Picasso, Frank Stella, Henri Matisse, Jasper Johns, Cy Twombly, Fab 5 Freddy.
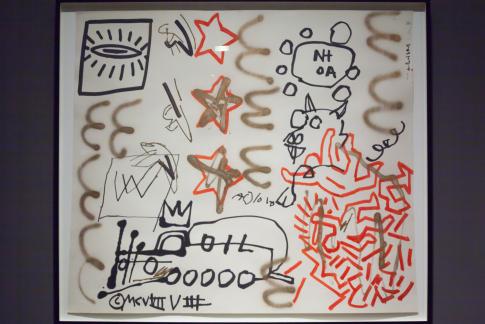
Jean-Michel Basquiat and Keith Haring: Untitled. Ink and gold spray paint on paper, 1981. Keith Haring Foundation.
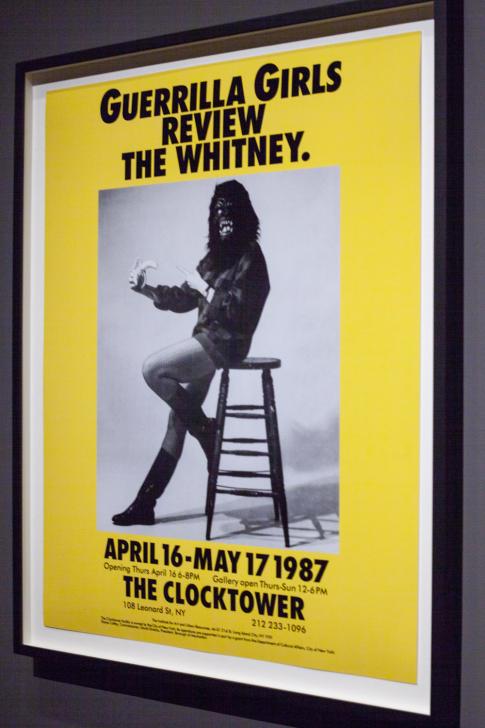
Guerrilla Girls Review the Whitney. 1987. Courtesy the Guerrilla Girls.

Keith Haring and LA II: Untitled (Female Bust). Ink and Day-Glo acrylic paint on fiberglass, 1983. Collection Larry Warsh.

Dean Chamberlain: Keith Haring, Nick Rhodes & Simon Le Bon on the Set Haring Painted for Arcadia‘s Appearance on MTV. Colour print, 1985. Collection Nick Rhodes.
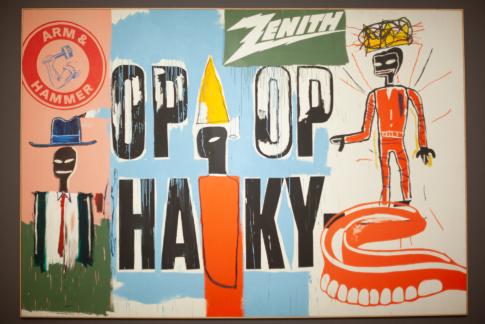
Basquiat, Warhol: Op Op. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.
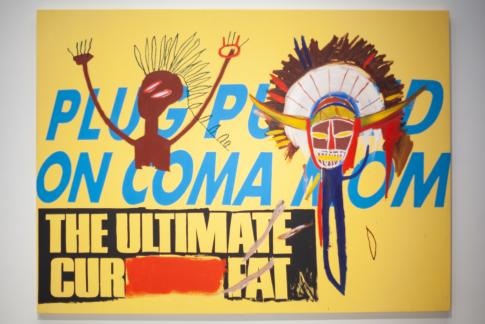
Basquiat, Warhol: Collaboration. Acrylic and oilstick on linen, 1984–85. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.

Basquiat, Warhol: Collaboration (Pontiac) No. 5. Detail, acrylic on canvas, 1984. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Basquiat: Gravestone. Acrylic and oil on wood panel, 1987. Private collection, courtesy Galerie Enrico Navarra.
Sorry, dass ich das Foto verschliert habe.

Katharina Grosse: Canyon. Detail, 14,5x5,7x9m, 3,7 tonnes, acrylic on aluminium, 2022.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.





Djan Silveberg: Téménos (τέμενος). Installation, building, technical and administrative equipment, furniture, staff, art production, visitors, 2022.
Google klärt Temenos auf als einen „abgegrenzten heiligen [Tempel]bezirk im altgriechischen Kult“. Online finde ich nichts in Verbindung zur Fondation, dafür aber ein paar ähnliche Bildtafeln auf Silvebergs Instagram, etwa von 2021 in Straßburg – ob er diese Tafeln heimlich als Interventionen anbringt?
--
Der Palais de Tokyo hatte geschlossen. Im benachbarten Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris (MAM) liefen nur die Sammlungsausstellungen, Sonderausstellungen öffnen erst wieder nach der Sommerpause.


Alfred Janniot. Detail.

Marcel Gaumont.


Kate Newby (*1979): The Edge of the Earth. Bricks, mortar, 2022.
Doch auch die Dauerausstellungen des MAM haben einiges zu bieten. Zunächst den „Salle Matisse“ mit seinen „Tänzen“ in der 2017 renovierten Galerie:

Henri Matisse (1869–1954): La Danse inachevée | The Unfinished Dance. Huile et fusain sur toile | Oil and charcoal on canvas, 1931. Achat Succession Pierre Matisse, 1993.

Ebd., Detail.

Henri Matisse: La Danse | The Dance. Huile sur toile | Oil on canvas, 1931–33. Achat à l‘artiste, 1936 sur le fonds d‘acquisition de l‘Exposition international de 1937.

Ebd. wurde die erste Version dieser Arbeit in der Barnes Foundation, Philadelphia unter Aufsicht von Matisse installiert, Foto aus Schaukasten.
Dann ging es zu den Schenkungen von Zao Wou-Ki 赵无极 (1920 oder 1921 in Beijing –2013 in Nyon). Zao zog 1947 nach Paris, wo er bis 2011 lebte, seit 1983 werden seine Arbeiten auch in China ausgestellt.

Zao Wou-Ki: I. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: I, 63. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: Six janvier 1968. Huile sur toile | Oil on canvas, 1968. Achat en 1971.

Ebd.: 01.10.73. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1973. Don de Mme Françoise Marquet-Zao en 2022.
Und nun in einem Sprint durch die hier präsentierte Moderne:

Otto Freundlich (1878–1943): Composition. Huile sur toile | Oil on canvas, 1911. Achat en 2014.

Bart van der Leck (1876–1958): Au marché. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Achat en 1991.

Auguste Herbin (1992–1960): Route muletière et maison à Céret. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Donation Henry-Thomas en 1976.

Pablo Curatella Manes (1891–1962): Le Guitariste. Bronze, 1921. Achat en 1962.

Francis Gruber (1912–1948): Les Malheurs de l‘amour. Huile sur toile | Oil on canvas, 1937. Don de M. François-Gérard Seligman en souvenir de Jacques Lassaigne en 2008.
Wenn schon keine Malerinnen ausgestellt werden, gibt es von mir wenigstens Frauenfiguren – obwohl sie namenlos und nur als Frauen „mit blauen Augen“, mit „rotem Hut“ benannt sind … oder schlicht als „Nackte“.

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme aux yeux bleus. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1918. Legs du Docteur Maurice Girardin en 1953.

Kees Van Dongen (1877–1968): Femme au chapeau rouge. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1925. Donation de Mme Mathilde Amos en 1955.
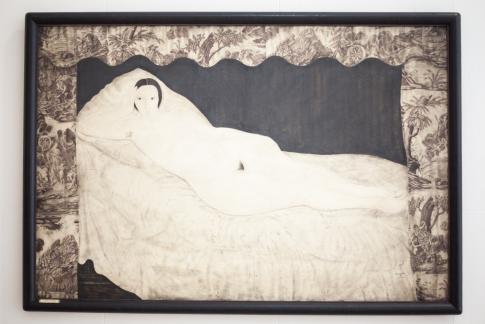
Léonard Foujita (1886–1968): Nu chouché à la toile de Jouy. Huile, encre, fusain et crayon sur toile | Oil, ink, charcoal and pencil on canvas, 1922. Don de l‘artiste en 1961.
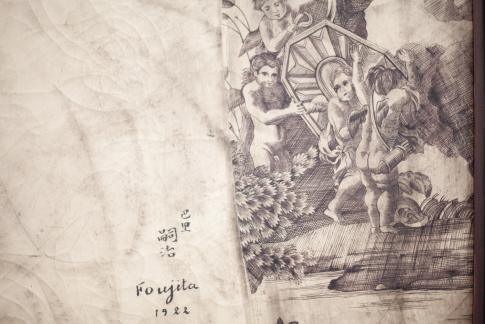
Ebd., Detail.

Gaston Lachaise (1882–1935): Floating Woman. Bronze, 1927 (fonte de 2015 | found 2015). Modern Art Foundry, New York, don de la Fondation Lachaise en 2019.

Jean Hélion (1904–1987): Figure bleue. Huile sur toile | Oil on canvas, 1935–36. Don de la Joseph Cantor Foundation, Indianapolis, en 1984.
In der Art Deco-Sektion sah ich dieses Zigarettenetui, das ich zu gern mein eigen nennen würde:

Paul Emile Brandt (1883–1952): Porte-cigarettes. Argent, or et laque | Silver, gold and lacquer, ca. 1937. Achat à l‘artiste en 1937.
An aktuelle(re)n Anschaffungen sind neben anderen folgende ausgestellt:
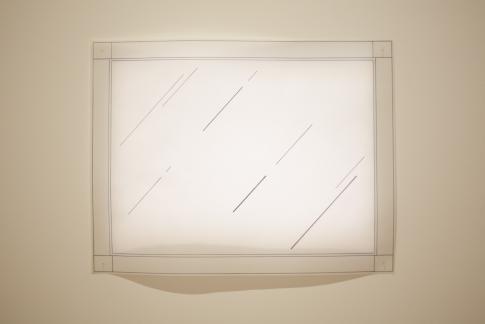
Marie Bourget (1952–2016): Reflet (Deuxième état). Encre sur calque | Ink on tracing paper, 1985. Don de Yves Bourget en 2021.

Pierre Weiss (*1950): panic room. #1, #2, #3, #4, #5. Aluminium, vernis, bois chêne, peinture acrylique | Aluminium, varnish, oak wood, acrylic paint, 1992–2022. Courtesy de l‘artiste et de la Galerie Valeria Cetraro.

Ebd., Detail.

Hubert Kiecol (*1950): Bundesbank. Detail, Béton | Concrete, 2010. Collection de l‘artiste.

Helmut Federle (*1944): Bird Migration at Azusa-Gawa River in Winter. Acrylique sur toile | Acrylic on canvas, 2022. Courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder.
--
Das Jeu de Paume, die Galerie nationale du Jeu de Paume, zeigt Frank Horvat: Paris, the World, Fashion, 26.6.–17.9.2023.

Prostitutes in a Police Car, Paris, for „Réalités“. Tirage argentique moderne | Modern silver-plate print, 1956.
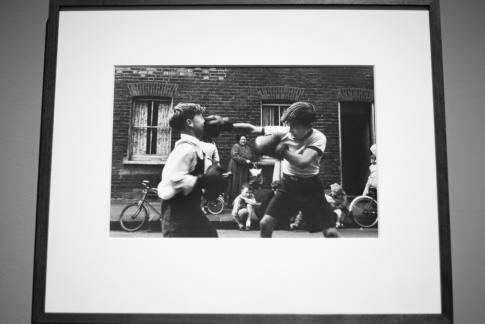
Chilrden Boxing, Lambeth, London, England. 1955. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

The Lido, Paris. 1956. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2002.
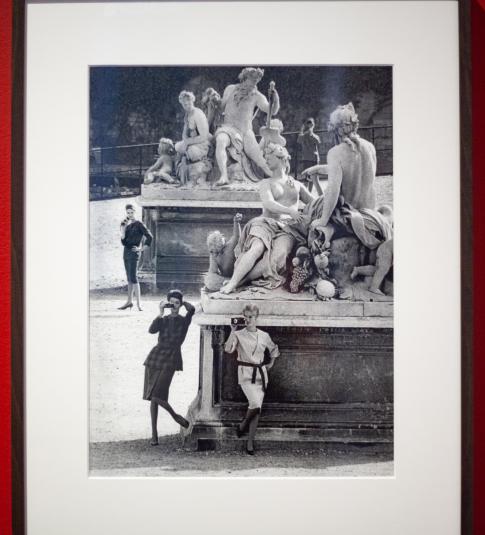
Place de la Concorde, Paris, for „Jardin des Modes“. Tirage lambda moderne | Modern lambda print, 1958.
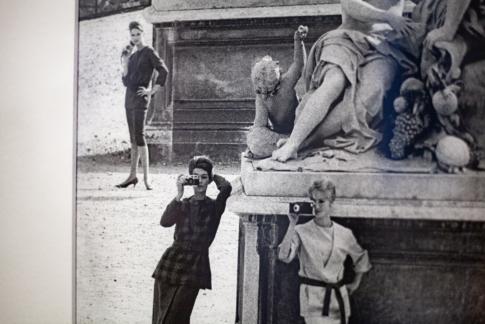
Ebd., Detail.

Judy Dent, for „Elegance“. Tirage argentique d‘époque | Vintage silver-plate print, 1962.

Woman and Shadow, New York, USA, for „Harper‘s Bazaar“. 1961. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.
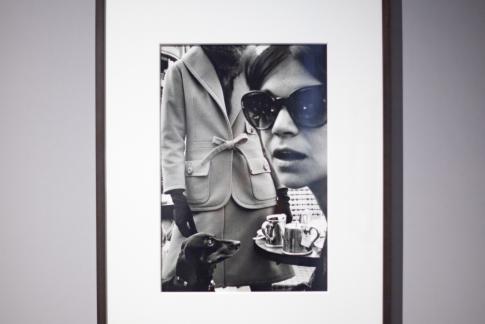
Carol Lobravico at the Café de Flore, Paris, French Haute Couture, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.
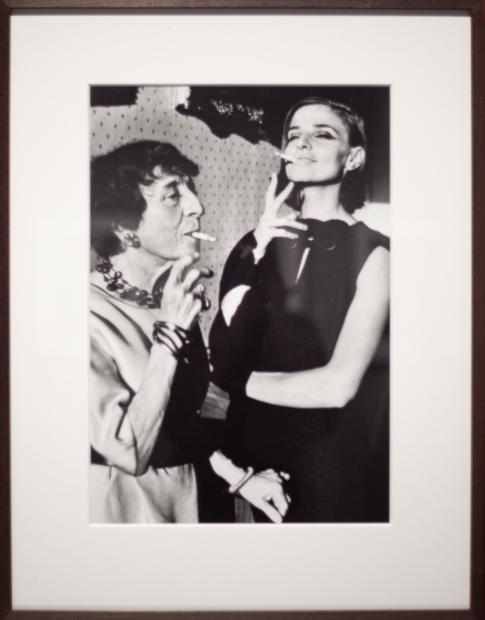
Iris Bianchi and Marie-Louise Bousquet, journalist, French Haute Couture, Paris, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

Television Studio with the Television Building in the Background, Cairo, Egypt. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1962.
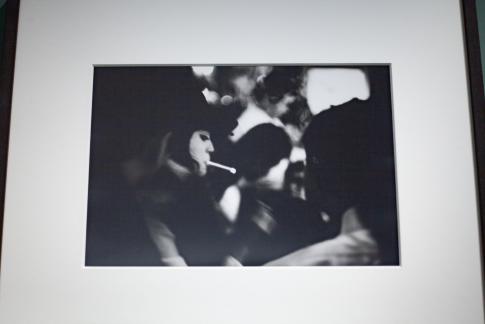
Soirée, Tokyo, Japan. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1963.
Und was für eine simple wie grandiose Idee, Einblick in die Schließfächer zu gewähren:
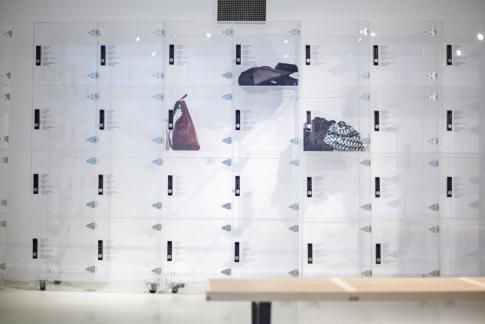
--
Direkt am anderen Eck des Parks kann man sich im Musée de l‘Orangerie Monets Wasserlilien ansehen, gemalt zwischen 1920–22, installiert 1927, die „Nymphéas“:

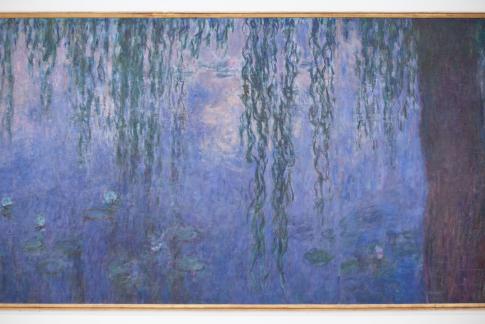
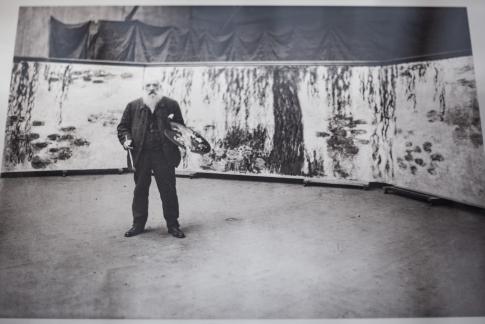
Henri Manuel (attributed): Claude Monet in the Studio of the „Grand Decorations“. Giverny, ca. 1920–22. Gift of M. Alfred Weil. Foto aus einem Schaukasten.
In den Kellergewölben der Orangerie mehr Moderne:

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme au ruban de velours. Huile sur papier collé sur carton | Oil on paper mounted on cardboard, ca. 1915.

Henri Matisse (1969–1954): Femmes au canapé ou Le Divan. Huile sur toile | Oil on canvas, 1921.
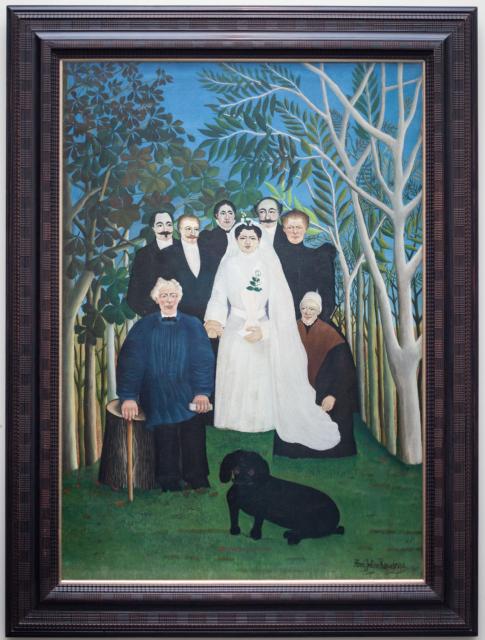
Henri Rousseau (1844–1910): La noce. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1905. Salons des Indépendants de 1905 et 1911.

Pierre-Auguste Renoir (1841–1919): Jeunes filles au piano. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1892.

Marie Laurencin (1883–1956): Les Biches. Huile sur toile | Oil on canvas, 1923.

André Derain (1880–1954): Arlequin et Pierrot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.

Maurice Utrillo (1883–1955): La Maison Bernot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.
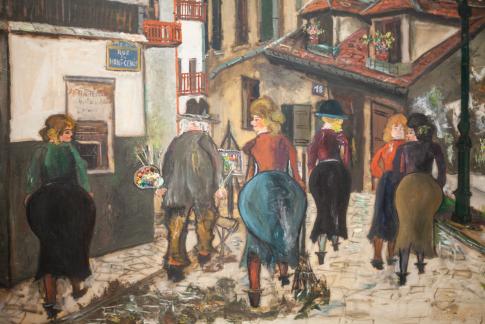
Ebd., Detail.

Pablo Picasso (1881–1973): Femme au tambourin. Huile sur toile | Oil on canvas, 1925.

Chaïm Soutine (1893–1943): La Jeune Anglaise. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1934.

Ders.: Paysage. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1922–23.
--

Zwischen den Parks Jardin de Tuilerier (dort: Jeu de Pleume und Orangerie) und Jardins des Champs-Élysées liegt der Place de la Concorde, der Platz der Eintracht. In seiner Mitte und in der Sichtachse vom Louvre zum Arc de Triomphe thront der 23,5m hohe Obélisque de Louxor, der Obelisk von Luxor, einem Geschenk von Ägyptens Vizekönig Muhammad Ali Pascha an Frankreichs König Louis Philippe I., aufgestellt 1836. Auf der Säule kann der komplizierte Transport nachvollzogen werden, auf einer technischen Infografik und wie das Obeliskenmützchen in Gold.
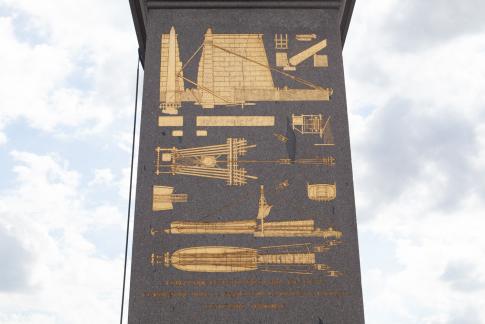
Unweit erinnert eine Steinplatte an den Platz der Revolution 1792–95 mit den Enthauptungen von Louis XVI. am 21.1.1793 und Marie-Antoinettes am 16.10.1793.

--

In der Lektüre von Frank Maier-Solks „Green Fields“ (s. u. in der Sommerlektüre) stieß ich auf den Garten des Friedens (Fountain de la Paix oder Japanischer Garten, Jardin Japonais) im UNESCO-Hauptquartier, Bauzeit: 1956–58, von Isamu Noguchi, Adresse: 7 Pl. de Fontenoy, 75007 Paris.
Auf der UNESCO-Seite fand ich nicht die Möglichkeit, nur den Garten besichtigen zu können, vielleicht muss man eine gesamte Tour buchen. Deshalb ging ich einfach vorbei und … stieß auf ein verwaistes Gelände. Immerhin aber mit einem Zaun, durch den man blicken und knipsen kann. Hier eine Beschreibung zum Garten von 1958, s. S. 32–34.



Dani Karavan: Square de la Tolérance en Hommage à Yitzhak Rabin. Don de l‘artiste et de l‘Etat d‘Israël, 1996.
Text in neun Sprachen, darunter: „Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.“, „战争起源于人之思想,故务需于人之思想中筑起保卫和屏障。“, „Constitution of the UNESCO“. Etwas dubios ist hier, dass die chinesische Version nicht wie die englische von einer „Verteidigung des Friedens“ spricht, sondern davon, dass „Schutz und Abschirmung errichtet werden“ müssten.



Finde den Eiffelturm.


--
In das Musée du Quai Branly, Adresse: 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris, wollte ich nicht hinein, aber das Gebäude aus Glas, bedeckt mit Pflanzen und Bäumen, sah online umwerfend aus. Also bin ich vorne in den Garten, durch den Park, am Gebäude vorbei, hinten wieder raus – kann ich eine falsche Seite erwischt haben oder war es irgendwann einmal faszinierend? Ich konnte mich leider nicht begeistern.
Auf dem Weg von hier nach dort findet man sich stets gern an der Seine wieder, zum Beispiel im Musée de la Sculpture en plein air, Adresse: 11 Bis Quai Saint-Bernard, 75005 Paris.

Jean Robert Ipoustéguy (1920–2006): L‘homme aux semelles devant [Der Mann mit den Sohlen vorne]. 1984. Hommage à Arthur Rimbaud (1854–91).

Ders.: Hydrorrhage. Bronze, 1975.

Ebd., andere Seite.

Antoine Poncet (1928–2022): Ochicagogo. Bronze, 1979.

Erwin Patkai (1937–85): Béton armé. Sculpture, 1973.
Auf der Suche nach ein wenig Gegenwart wurde das Musée Rodin von der Liste gestrichen.

Brückenpfeiler in der Form eines Raumschiffes mit Mutter und Kind als Spitze.


Allgemein schien die Stadt in Sommerflucht. Die Gegenwartskunst kam einem immerhin in Schnipseln und Stanzeln unter die Linse. Die Kunstviertel aber hatten geschlossen.

Geschlossen hatte der Startup-Campus mit Popup-Stores Station F, Adresse: La Halle Freyssinet, 5 Parv. Alan Turing, 75013 Paris.


Ebd., Food Market.
Ebenfalls geschlossen waren die Galerien in der benachbarten Rue Louise Weiss sowie das gesamte nördöstlich gelegene Kulturzentrum in der ehemaligen staatlichen Leichenhalle namens Le Centquatre, Adresse: 5 rue Curial, 75019 Paris – nächstes Mal. Als weitere Galerienviertel in der Stadt könne man, vermutlich außerhalb der Ferienzeit, ins Frac île-de-France, Adresse: 22 Rue des Alouettes, 75019 Paris, und Umgebung, sowie in das beim Centre Pompidou gelegene Areal Le Marais.

Die Fahrstuhlröhre am Centre Pompidou sollte man im Sommer wegen Überhitzung allerdings besser meiden. Eine tolle Aussicht hat man natürlich trotzdem.


Hier in der Nachbarschaft vom Pompidou.

Auch das nördlich gelegene Repair Café La REcyclerie, Adresse: 83 Bd. Ornano, 75018 Paris, wurde auf Sparflamme betrieben (vielen Dank für den Tipp an Andi).

Wenn man möchte, so findet man in den Gerüstkonstruktionen am Notre-Dame Gegenwartskunst. Gut gemacht sind dort auch die Infografiken, die einen durch den Wiederaufbau führen. Lass es dir gut ergehen, du wunderbares Gebäude.


Weiter durch die Gegend …

Finde die Touristen.

Finde den zweiten Eiffelturm in diesem Blogpost.

Entlang der Seine sieht man die eine oder andere Brücke mit den von mir sehr geliebten Groteskköpfen.

--

Was ein wundersam verwinkelter Durchgang, dachte ich, schoss dieses Bild und schlüpfte hinein. Aber, ach, ich falle immer wieder auf Eckchen dieser Art herein. Letztens erzählte mir jemand, dass nur Rüden ihr Revier markierten – als könnten Männer nichts dafür, es sei halt ihr Trieb? Google meint dazu, dass auch Hündinnen gelegentlich mitmachten, vor und während der Brunst und vor allem, wenn ein annehmbarer Rüpel in der Nähe weile. Man kann es sich also abgewöhnen. Werte Herren allerorts: Bitte zivilisiert euch endlich. Oder sollte man doch damit anfangen, Fotos von euch zu machen? An der Seine findet ihr in Abständen von einer halben Flasche Bier diese Auffänger:

Derweil in:
Berlin

Pride Parade vor der Neuen Nationalgalerie, 22.7.2023.
Isa Genzken: Rose IV. 8,25m, 646kg, Aluminium, 2016, aktualisiert | updated 2023.
Die Neue Nationalgalerie zeigt Isa Genzken: 75/75, 13.7.–27.11.2023. Anlässlich Genzkens 75. Geburtstag werden 75 ihrer Skulpturen aus allen ihren bisherigen Schaffensphasen ausgestellt. Die Show ist sehr zu empfehlen.

Ausstellungsansicht, Detail.

Weltempfänger. 160x215x40cm, concrete, steel, 1988–89. Private collection, London.

Data. 35x40x60cm, plaster, jute, wire, wood, 1984. Thomas Borgmann, Berlin.

Mein Gehirn. 24x20x18cm, plaster, metal, paint, 1984. Collection Daniel Buchholz and Christopher Müller, Cologne.

Institut. 68x27x14cm, plaster, paint, 1985. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Wega. 99x45x25cm, plaster, paint. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Untitled. Detail, 337x360x300cm, installation consisting of 7 parts (4 towers, 3 columns), mirror foil, glass, plastic flower, cigarette, tin foil, spray paint, plaster, acrylic, woven polypropylene, medication instructions, coloured tape, photographs, plastic bag, metal clips, magazine covers, newspaper, aluminium, paper, 2015. Courtesy Galerie Buchholz.

Im Vordergrund | In the front: Office Lighting. 174x310x75cm, fabric, metal, plastic, MDF, acrylic, tape, spray paint, polystyrene, colour print on paper, 2008. Courtesy Galerie Buchholz.

New Building for Berlin. 225x60x45cm, glass, epoxy resin, wood, 2005. Private collection, London.

Fenster. 540x300x100cm, epoxy resin, steel, 1992. Thomas Borgmann, Berlin.

Ebd., Detail.
--
Im Kupferstichkabinett läuft World Framed: Zeitgenössische Zeichenkunst der Sammlung Schering Stiftung, 7.7.–8.10.2023.

Morgan O‘Hara (*1941): Movement of the Hands of Flutist Roy Amotz Performing at the Kupferstichkabinett, Berlin, 13 September 2017. Aus der Serie | From the series: Live Transmissions. 3-teilig, Bleistift auf Papier | 3 parts, pencil on paper, 2017. 2018 erworben von der Künstlerin | 2018 acquired from the artist.

Jorinde Voigt (*1977): Deklination II (26 Standpunkte), Rotation doppelter akustischer Impuls[e] (N, O, S, W; horizontale Distanz, vertikale Distanz, Volume in %, Dauer in Sek., Loop, Rotationsrichtung, Rotationsgeschwindigkeit | Declination II (26 Positions), Rotation Double Acoustic Impulse (N, O, S, W; Horizontal Distance, Vertical Distance, Volume in %, Duration in Sec., Loop, Rotation Direction, Rotation Speed). Detail, Bleistift und Tinte auf Papier | Pencil and ink on paper, 2008. 2008 erworben im deutschen Kunsthandel | 2008 acquired on the German art market (Galerie Fahnemann, Berlin).
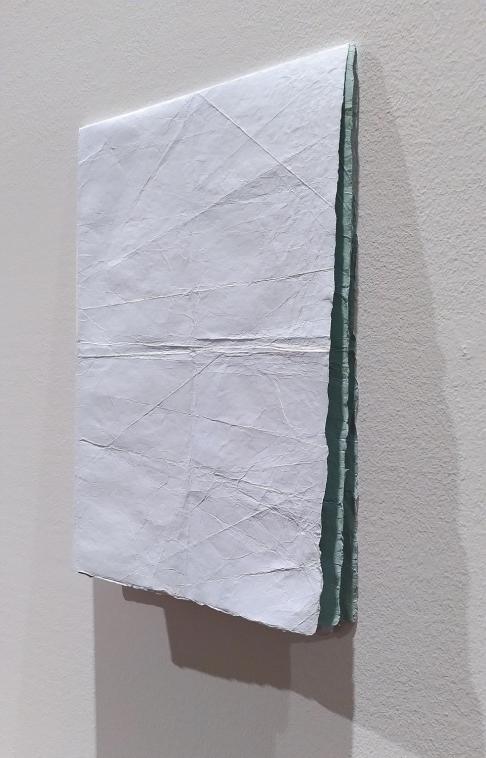
N. Dash (*1980): Aus der Serie | From the series: Commuter. Faltungen, Acryl auf Papier | Folds, acrylic on paper, 2021. 2022 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Mehdi Chouakri, Berlin).

Tom Chamberlain (*1973): Untitled. Nadelstiche in Papier | Pinpricks on paper, 2008. 2011 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Aurel Scheibler, Berlin).
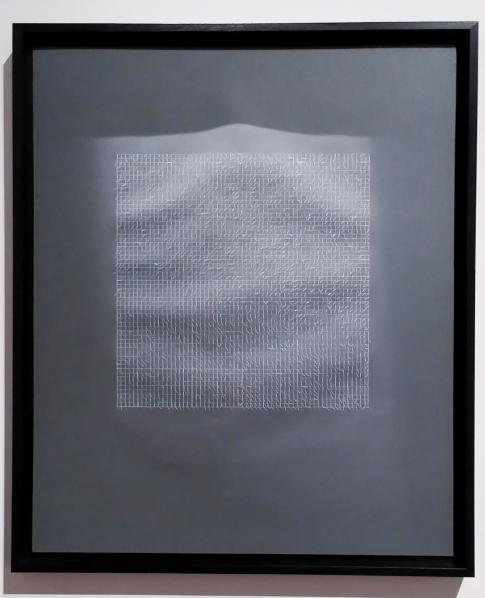
Fiene Scharp (*1984): Untitled. Weiße Haare, Tinte, Klebeband auf grauem Papier | White hair, ink, tape on gray paper, 2013. 2014 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (401 Contemporary, Berlin).
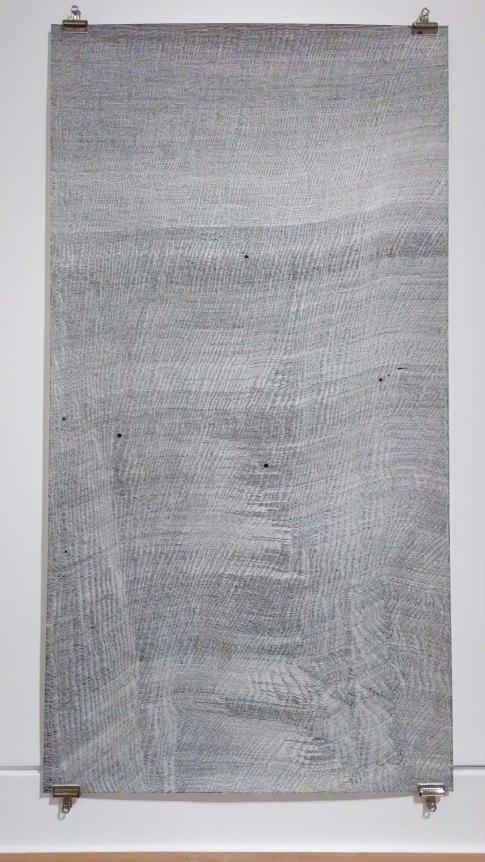
Sophie Tottie (*1964): Written Language (line drawings) XI. Pigmenttinte auf Papier | Pigment ink on paper, 2009. 2013 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Andrae Kaufmann, Berlin).
--
Frontviews zeigte Garden of Delete: Inflections, 7.7.–19.8.2023, im Haunt mit Kate Albrecht Fulton, Alice Dittmar, Delia Jürgens, Leon Manoloudakis, Marie Rief, Qiu Shihua und Dimitris Tampakis.
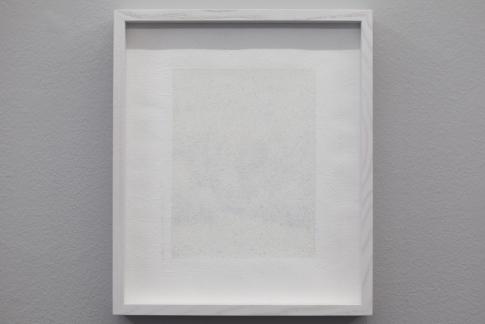
Qiu Shihua: Untitled. 30,5x23cm, watercolour and oil on paper, 2019.

Alice Dittmar: Shadowplay_screens I<>II. 185x95cm, ballpoint pen on photography, mounted on alu-dibond, 2021–22.

Dimitris Tampakis: Your CEO Is Probably a Psychopath. 340x10cm, aluminium, 2021.

Ebd., Frontperspektive.

N. K. Jain: Berlin Melodie. Wandgemälde im Innenhof des Haunt, beauftragt vom Bezirksamt Tiergarten, 1978.
--

Die Weißensee Kunsthochschule Berlin öffnete die Türen für ihren alljährlichen Rundgang, 22.–23.7.2023. Wir hörten uns den Vortrag von Wolfgang Ullrich an: Der Streit um die Autonomie der Kunst (hier vom 11.1.2023 an der Uni Köln). „Ich bin Kunstkritiker, nicht -produzent“, sagte er und stellte seine aktuelle Arbeitshypothese vor, das (gegenwärtige) Kunstverständnis in die zwei unterschiedlichen Typen von autonomer Kunst und postautonomer oder auch aktivistischer Kunst zu gruppieren.
Unabhängigkeit und Kunstfreiheit seien das Ideal seit der westlichen Moderne, ihr Sinn speise sich aus der Differenz von Werk und Publikum, dem damit eine Chance auf Veränderung, Kritik und Sensibilisierung vermittelt werde. Das Thema autonomer Kunst sei die Therapie, die Beschäftigung mit einem Kunstwerk werde zur Auseinandersetzung mit sich selbst, möglicherweise zu einem Bekehrungserlebnis. Hier herrsche eine klare Trennung zwischen Sender und Empfänger (Beispiel: Joseph Beuys). Diesem eher hermetischen und konfrontativ bis einschüchternden Ansatz entgegen fordere die postautonome Kunst aufgrund der aktuellen Weltlage eine klare Haltung. Ihr Thema sei die Identifikation. Hier gehe es um die Bestätigung zwischen Sender und Empfänger, dass man auf derselben Seite stehe, kooperiere. Man interagiere nicht, sondern repräsentiere, man unterwerfe nicht, sondern verstehe sich in Komplizenschaft (Beispiele: Zentrum für politische Schönheit, Tools for Action). Es gehe um Empowerment, anstatt „Du musst dein Leben ändern“ heiße es „Du lebst richtig, erfährst Unterstützung, um es leben zu können“. Anstelle der Verheißung von Erfahrung werden Augenhöhe geschätzt, ein Safe Space geschaffen, Inklusivität, die nicht ausschließen will. Das Konfliktpotential mit Institutionen, das Rechtsgut der Kunstfreiheit, die Mitbespielung des Marktes durch die Demokratisierung der Kunst, die Fragen um Cancel Culture, Propaganda, Kollektivität, Aktivismus je nach Sozialisierung, nach privilegierten Sonderrechten, unterschiedlicher Milieuzugehörigkeit führten zu einer Auseinandersetzung und Debatte um Positionen in der Gesellschaft. So richte sich die Störung von Kunstwerken in Museen der Letzten Generation – die Zukunft werde entscheiden, ob ihr Aktivismus als Kunstaktionen verstanden werde – gegen die ungestörte Rezeption von eben jenen Kunstwerken, gegen die therapeutische Kontemplation. Der Dialog zur Besserung solle gestört werden, weil das unschuldige Auge nicht mehr möglich sei. Vorher erschienen Frieden, Wohlstand, Freiheit möglich, die Motivation sei vorhanden gewesen, jetzt heiße es, Kräfte zu sammeln.
Aktuell befänden wir uns zwischen beiden Phänomenen. Dass Ullrich die beiden Typen nicht als dualistisches Entweder-oder sieht, sondern als Versuch einer neuen Begriffsbestimmung, nicht schematisch, sondern in Nuancen, muss er in der abschließenden Fragerunde erneut klarstellen. Natürlich habe es auch vorher partizipative Formate gegeben, aber die Grenzziehung zwischen der Kunstwelt und den anderen, den Profis und Amateuren, sei aufgeweicht.
Mehr dazu in Wolfgang Ullrich (2022): Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Berlin: Wagenbach.
--
Ohne sich zeitlich festlegen und einen Supersparpreis ergattern zu müssen, kann man anstatt mit dem ICE von Hamburg nach Berlin in 1:45 Stunden auch gut in insgesamt vier Stunden mit dem Regionalzug etwa über Schwerin fahren. Leider steckt das Staatliche Museum Schwerin bis voraussichtlich Herbst 2024 in Umbaumaßnahmen, aber der Burggarten beim Schloss ist sehr schön.

Schweriner Schloss.
Hamburg
Der Kottwitzkeller von Wolfgang Scholz und Dieter Tretow in der Kottwitzstraße 10 nahe Hoheluftbrücke in Eimsbüttel fand erstmals 1996 statt. Die jährlichen Ausstellungen wuchsen im Laufe der Zeit aus den Kellerräumen heraus zu einem Kunstfest in die gesamte Straße hinein, in die anliegenden Keller, Hinterhöfe und Wohnungen. Dem ersten Thema „Licht“ folgte nun das letzte: „Licht aus“, 26.–27.8.2023.

O. A.

O. A.
Vor diesem Guckloch wurde ein Licht aktiviert, wenn man sich in der dafür richtigen Position befand.
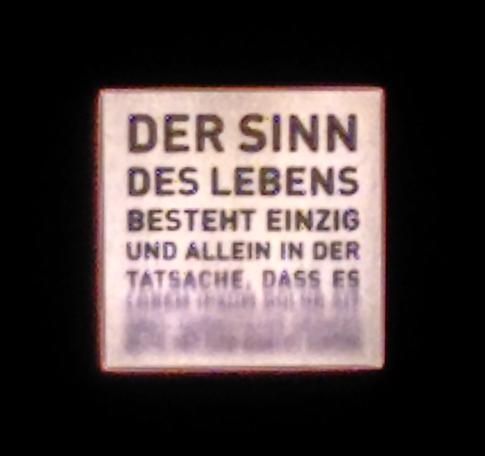
Ebd., Detail, Text: „Der Sinn des Lebens besteht einzig und allein in der Tatsache, dass es …“
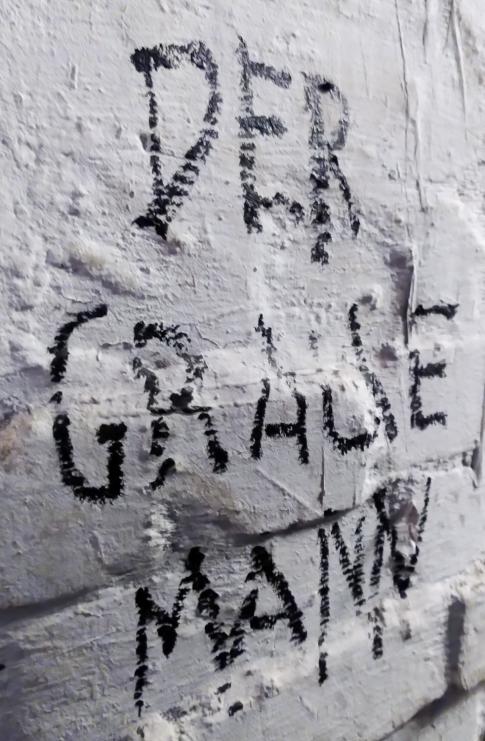
O. A., Text: „Der graue Mann“.
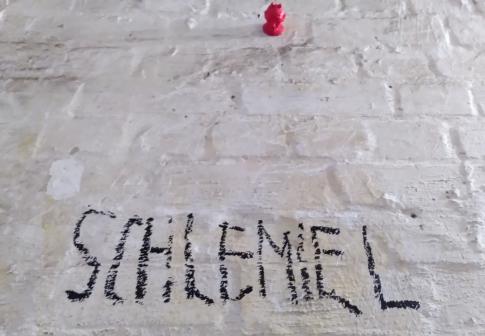
O. A., Text: „Schlemiel“.
Das Wort musste ich googeln, es ist jiddisch für einen Pechvogel oder Narren.

Gipsabdruck von Michael Dankers: Mißbrauchte Landschaft.
Koffer von Wolfgang Scholz, der im gesamten Gewölbe sieben Koffer mit Erinnerungen und/oder neuen Zusammenstellungen aufgestellte.
Text an der Wand rechts, O. A.: „Keine Macht für niemand“.

Luise Czerwonatis: „…, die Maschine steht still.“

Oliver Kunst: Wort im Dunkeln. Audioinstallation, Text: „Tatort V / III“.

Ulla Penselin: Der KottwitzKeller hatte viele Gesichter.
Bei dem schwarzen Ensemble handelt es sich um den Grundriss und damit Lageplan des Kellers.

Tanja Soler Zang: Kontakt. Detail, Raum-Klang-Installation.
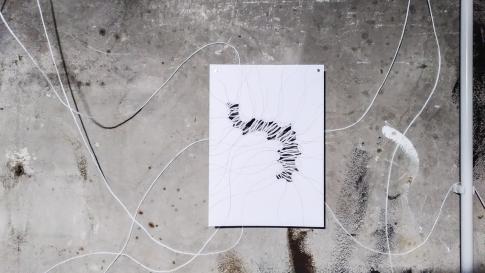
Ebd., Detail.
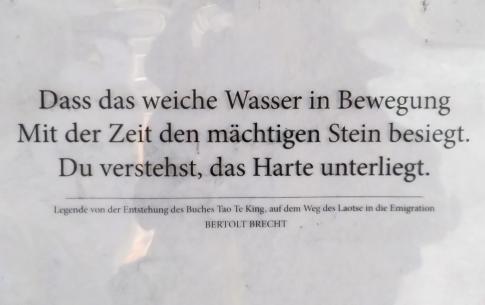
O. A.
Selbst China war präsent, auf diesem Schild und mit dem Text: „Dass das weiche Wasser in Bewegung / Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. / Du verstehst, das Harte unterliegt. // Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King, auf dem Weg des Laotse in die Emigration / Bertolt Brecht“.
--
Anlässlich all des Trubels um die Köhlbrandbrücke (s. jüngst etwa die Hamburg-Ausgabe der Zeit, Nr. 37) machte ich Anfang August eine kleine Fahrradtour zur 1974 fertiggestellten sogenannten Schrägseilkonstruktion des Architekten Egon Jux.

Wikipedia erklärt, der Brückenzug soll ingesamt 3618m lang sein – mit der östlichen Rampe von 2050m, 520m Elbüberquerung und 1048m westlicher Rampe. Als „lichte Höhe“ wird das Maß vom Untergrund bis zur Unterkante eines Tragwerks bezeichnet: hier 53m bei mittlerem Wasserstand; spannender finde ich die Höhe der beiden Pylone: knapp hundert Meter (135m inklusive der 37m hohen Stahlbetonpfeiler).


Mit der Fähre kommt man direkt von der Ost- auf die Westseite über den Köhlbrand, von Neuhof nach Waltershof. Nächstes Jahr muss ich unbedingt an der Fahrradsternfahrt teilnehmen, bei der in Hamburg eine Route über die Brücke führt.

Lübeck

Eine Reise nach Lübeck lohnt sich neben dem Streunern durch die mittelalterlichen Gänge der Altstadt immer wieder.
Vom Museum Behnhaus Drägerhaus läuft in der Kunsthalle St. Annen Mehr Licht: Die Befreiung der Natur, 12.7.–15.10.2023.

Andreas Aschenbach (1815–1910): Wasserstudie, Travemünde | Water Study, Travemünde. Öl auf Leinwand | Oil on canvas, 1835. Privatsammlung | Private collection.

Eduard Wilhelm Pose (1812–78, zugeschrieben | attributed): Waldbach | Forest Stream. Öl auf Leinwand auf Holz | Oil on canvas on wood, 1831. Privatsammlung | Private collection.
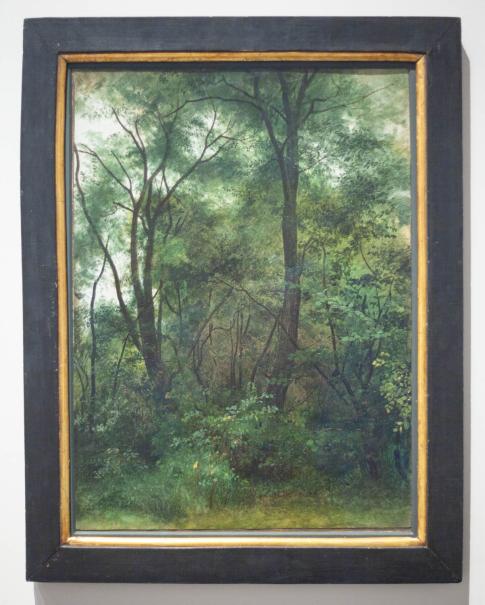
Christian Friedrich Gille (1805–99): Waldstudie | Forest Study. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, ca. 1840. Privatsammlung | Private collection.

Rosa Bonheur (1822–99): Landschaft im Nebel | Landscape in the Fog. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, undatiert | undated. Privatsammlung | Private collection.

Maximilian Hauschild (1810–95): Blick aus dem Fenster mit Weinreben | View from the Window with Grapevines. Öl auf Papier | Oil on paper, undatiert | undated. Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris.

Arnold Böcklin (1827–1901): Sonnenbeschienene, von Vegetation überwucherte Felswand in den Aequerbergen östlich von Rom | Sunlit Rock Face Overgrown with Vegetation in the Aequera Mountains East of Rome. Öl auf Leinwand, doubliert | Oil on canvas, doubled, ca. 1850. Privatsammlung | Private collection.
--
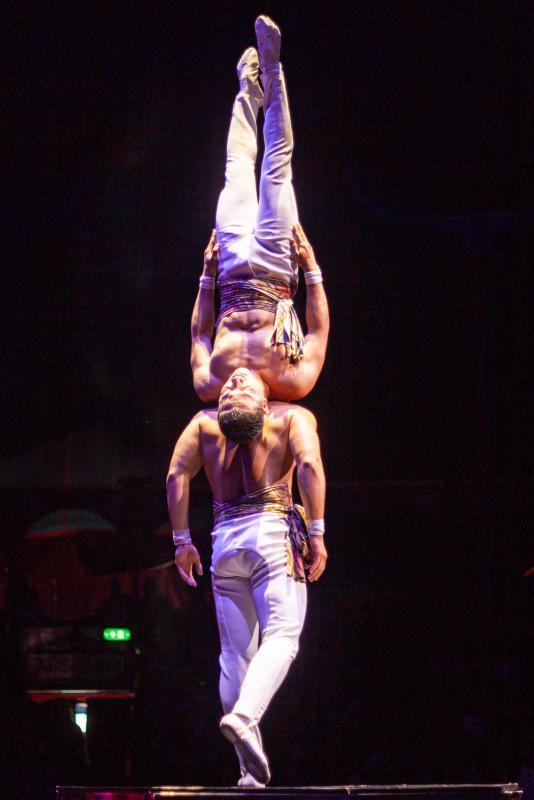
Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, kommt man seit Ewigkeiten einmal wieder in einen Zirkus. Roncalli gastierte im August in Lübeck neben dem Holstentor.
Sommerlektüre
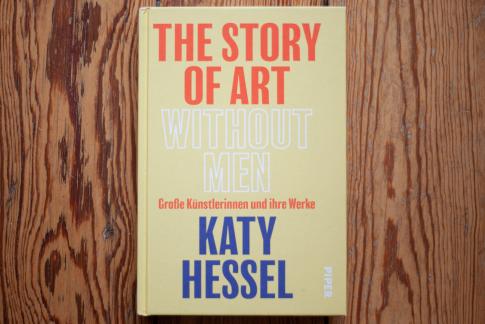
Katy Hessel (2022): The Story of Art without Men: Große Künstlerinnen und ihre Werke. Übs.: Marlene Fleißig, Astrid Gravert, Gabriele Würdinger und Maria Zettner. München: Piper.
Im Format von und in Anlehnung an Gombrichs „Die Geschichte der Kunst“ (The Story of Art), der „Bibel“, dem „Standardwerk“ der Kunsthistorik, erstmals 1950, bis 1996 in 16. Auflage erschienen, bricht Hessel in ihrer Parallelgeschichte „ohne Männer“ die westliche männliche Kunstgeschichtserzählung auf. In Gombrichs Kanon käme nur eine einzige Frau vor – ich habe sie auf die Schnelle nicht gefunden –, bei Hessel treten Männer nur am Rande und meist unrühmlich auf. Es handelt sich nicht um eine Abrechnung, sondern veranschaulicht, dass Frauen immer schon, allen Widerständen zum Trotz künstlerisch tätig waren. Gut, Gombrich beginnt in der Urzeit, Hessel um 1500, und auch wenn Hessel versucht, die nicht-westliche Welt miteinzubeziehen, so bleibt auch sie vermehrt in diesem Kosmos.
Doch gibt es großartige Persönlichkeiten zu entdecken, bekannte und noch viele, viele unbekannte, von Maria Sibylla Merian (habe mir gleich ihr Insektenbuch besorgt), Mary Cassatt, Leonor Fini, Gluck, Atsuko Tanaka, Alina Szapocznikow, Doris Salcedo bis Flora Yukhnovich. Interessant finde ich den möglichen Zufall, dass zwei Ausstellungen im Hamburger Bucerius Kunst Forum nach Erscheinen von Hessels Buch von ihr aufgenommene Exponate zu deren Titelbildern machten, das von Gabriele Münter (S. 133) und das von Lee Miller (S. 212).
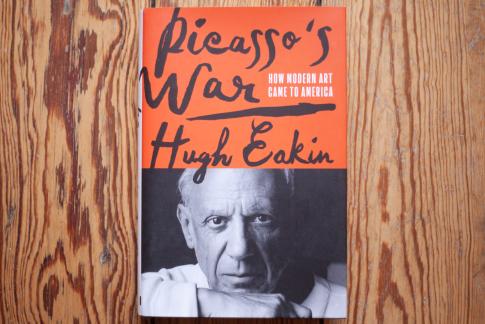
Hugh Eakin (2022): Picasso‘s War: How Modern Art Came to America. New York: Crown.
Auf dieses Buch stieß ich durch eine Podcastfolge von Dialogues, in der Helen Molesworth anlässlich des 50. Jahrestages von Picassos Tod (8.4.1973) mit Hugh Eakin spricht, vom 12.4.2023, 38 Min., Stand: 5.9.2023. Die Amis sind fabelhaft darin, wissenschaftliche Fakten mit Erzählkunst zu verbinden, so liest sich auch dieser Schinken wie ein Roman (und ist weitaus besser als die Podcastfolge). Anhand einflussreicher und visionärer Kunstmäzen·innen wird der über Jahrzehnte gescheiterte Versuch und endlich erfolgreiche Durchbruch beschrieben, Picasso und die moderne Kunst dem amerikanischen Publikum näherzubringen. Eakin geht dabei nicht zimperlich mit der größtenteils konservativen US-Bevölkerung um, er durchstreift die Zeit von der später als legendär bezeichneten Armory Show 1913 in New York bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dafür spürt er insbesondere den Lebenswegen von John Quinn (1870–1924), Jeanne Robert Foster (1879–1970), Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), Paul Rosenberg (1881–1959) und Alfred H. Barr Jr. (1902–81) nach.
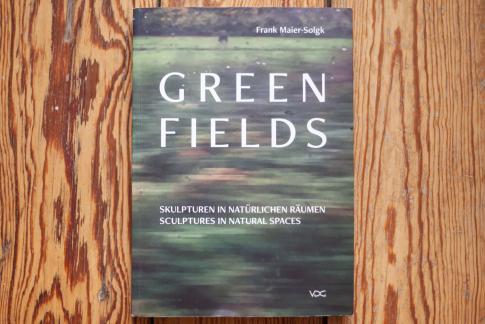
Frank Maier-Solk (2023): Green Fields: Skulpturen in natürlichen Räumen | Sculptures in Natural Spaces. Ilmtal-Weinstraße: VDG.
Frank Maier-Solk sieht den offenen Raum im „Green Field“ als Alternative zu Brian O‘Dohertys erstmals 1976 beschriebenem „White Cube“, dem modernen Ausstellungsraum in hermetisch abgeriegelter Sterilität – als neuerliche Platzierung der Kunst an einem bestimmten Ort, der eine eigene, externe Dramaturgie mit sich bringt. Maier-Solk beginnt seine Beschreibung in der westlichen Nachkriegszeit, in der Parks zu den ersten Ausstellungsorten wurden, weil Kriegsschäden dort schneller beseitigt werden konnten. Darüber hinaus aber hätten öffentlich zugängliche Anlagen auch den neuen Werten der Völkerverständigung entsprochen und als Ausdruck für Demokratie und Humanismus gegolten (ab S. 45).
Nach Exkursen über die amerikanische Land Art der 1960er und -70er Jahre werden „Grüne Felder“ in der Stadt dargestellt, etwa die Skulptur Projekte Münster und Entwicklungen auf der documenta, sowie „Grüne Felder“ auf dem Lande, etwa Refugien wie die in Ganslberg bei Landshut oder eigene Anlagen wie die von Niki de Saint Phalle in der Provence. Als neuere Phänomene skizziert Maier-Solk „Anthropozän-Kunst“, „Ökologische Kunst“ und „Revier-Landschaften“ (ab S. 179) sowie die „auffallend große Zahl neuer privater Skulpturenparks“ der letzten Jahre (S. 10) als ein „Natur-Revival“ (S. 13). Er beschreibt den Garten zum einen weiterhin als Sehnsuchtsort und Domestizierung der Natur und zeigt auf, wie das zunehmende Umwelt- und Naturbewusstsein zu einer „zusätzlichen Renaissance einer Kunst unter freiem Himmel geführt“ habe (Klappentext).
Maier-Solk brachte mich auf den Besuch von Isamu Noguchis „Garten des Friedens“ (Fountain de la Paix, Bauzeit: 1956–58) im UNESO-Hauptquartier in Paris (S. 64–66, s. für Bilder oben). Besonders hat mich auch gefreut, dem Engadiner Künstler Not Vital, den ich von Urs Meile aus Beijing kannte, hier zu begegnen (S. 248–52).
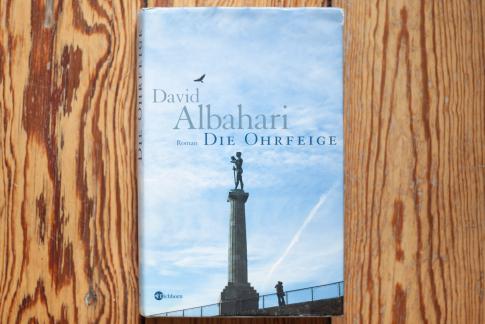
David Albahari (2007): Die Ohrfeige (Original: Pijavice). Übs.: Mirjana und Klaus Wittmann. Frankfurt a. M.: Eichborn.
Diesen wunderbaren Roman las ich auf die Empfehlung aus dem Nachruf von Alida Bremer: Zum Tod einer wichtigen serbischen Stimme, in: Fazit, DLF, 31.7.2023, 11:14 Min., Stand: 5.9.2023. Laut Bremer sollte es in diesem Werk von David Albahari (1948–2023) um Zweifel gehen, vor allem um Selbstzweifel der eigenen Wahrnehmung. Wer kann da widerstehen? Hier wird man noch dazu mit einer grandiosen Sprache, mit in Schalk verpackten Weisheiten und skurrilen Wendungen beschenkt.
Der namenlose Ich-Erzähler schreibt aus einem unbenannten Exil, in das er wegen der ihm widerfahrenen und in der serbischen Gesellschaft und Politik immer nur in Nebensätzen angedeuteten Ereignisse fliehen musste. Es geht um einen jüdisch-kabbalistischen Verschwörungsmythos, der auf antisemitische Nationalschergen trifft und Ende der 1990er Jahre im Belgrader Stadtbezirk Zemun spielt. Der Protagonist beobachtet am Ufer der Donau, wie ein junger Mann einer jungen Frau die titelgebende Ohrfeige verpasst. Durch diese Geste wird unser zweifelhafter Held, im Gegensatz zu Albahari kein Jude, in den Strudel der Vertreibung der jugoslawischen Juden und Jüdinnen gezogen. In seinem Bann begibt er sich auf die Suche nach Antworten, auf die er kaum die Fragen kennt. Bald sieht er in allem möglichen „einen Köder, der mich noch tiefer in eine Geschichte hineinziehen sollte, die ich im Grunde selbst konstruiert hatte“ (S. 304). Die fehlenden Absätze und der häufige Konjunktiv unterstreichen die Gemengelage zwischen Wahn und Wirklichkeit, Paranoia und echter Gefahr.
Tags für diesen Beitrag 这篇文章的标签: Unterwegs 路上, Ausstellung 展览, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bildende Kunst 美术, Hamburg 汉堡, Bücher 书籍
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 1. Dezember 2022
Wildwunsch
youjia, 17:59h
Gerade durchforste ich meine zahlreichen Kulturgut-Ordner, um meine tatsächlich seit 2014 inhaltlich nicht aktualisierte Website auf einen etwas neuer Stand zu bringen. Dabei stoße ich immer wieder auf Konzepte und Texte, die in der digitalen Schublade geblieben sind. Da ich heute noch ein wenig Pflichtlektüre zu erledigen habe und um mich dem Sog der Ordnerwindungen zu entziehen, poste ich hier ist ein Beispiel wiedergefundenen Geschreibsels:
Theoretisch mag ich die Idee des einfach einmal Draufhauens. Nicht nur wie bei Wild Tales mit Grund und aus echtem Es geht nicht Mehr heraus, sondern auch nur so aus Lust an der Sache des Freisetzens von Energien wie bei Fight Club. Aggressionen ein Ventil genehmigen, berechtigterweise oder einer Laune folgend. Den Körper über den Geist siegen lassen, das Archaische über die Zivilisiertheit. Die nett in Reih und Glied hinterm Gartenzaun gepflanzten Blumen ausreißen, den Computer vom Tisch fegen, Fernseher aus dem 10 Stock werfen, jetzt nicht die Frau, das Kind, jemand Schwächeren schlagen, nicht gleich Amok laufen, aber auf all diese Niedlichkeit kotzen. Einmal richtig schön grob sein gegen das Heileweltgeflöte um einen herum.
Bis wirklich wieder einer durchdreht ? sich die Geschichte um eine neue, seine alte Achse dreht.
Ob nun die Unterjochten gegen ihre Unterjocher aufbegehren, wenn etwas hakt, gibt es immer einen Grund, weil es immer Ungerechtigkeit gibt, der entgegenzutreten immer wichtig ist ? ist das der eigentliche Grund? Mir scheint dies ein anderes Thema. Was ist es, das uns nicht zur Ruhe kommen lässt, warum der friedliche Hippietraum nicht funktioniert? Ego, Wahn, Trieb?
Es existieren therapeutische Maßnahmen: Schreien im Wald, Sandsäcke, allgemein führt körperliche Aktivität zum Auspowern. Habe ich auch einmal wieder nötig, ja. Doch ist es nur das? Wenn Körper und Geist nicht im Einklang sind? Oder ist es ein Kitzel, vergleichbar mit und dort in gelenkten Bahnen ausgefochtenem Extremsport?
Auch ich spüre manchmal ein gewisses Aggressionspotential in mir. Oder merke gelegentlich an Reaktionen eines Gegenüber, dass ich zu harsch war.
Ich wollte dem ganzen Theoretisch mag ich die Idee des Draufhauens ein Aber hinzusetzen. Denn ich lese gerade, nicht sonderlich passend als Nachtlektüre, von Joseph Roth Das Spinnennetz, in dem es um den Niedergang der Weimarer Republik geht, Protagonist ist eines dieser halb selbstveropferten, viel mehr aber dumpfen, stumpfen, sich selbst warum auch immer zu wichtig nehmenden Gestalten, die zunächst in sich hineinschreien, dann sich mehr und mehr Rechte herausnehmen. Mir dreht sich beim Lesen alles um. Gestern wollte ich diesem Kerl in seine Eingeweide. Heute will ich mich angeekelt abwenden. Dieses Lauern ? wonach?, diese Bereitschaft ? wozu? Verlangt es nach einem Knall? Hat man einen Knall? Größenwahn, Sucht nach Anerkennung, Minderwertigkeitskomplexe? Böse? Schlimmer: reflektiert böse? Schwarzweiße Kategorien in Ermanglung eines greifbaren Adjektivs.
Also doch lieber Zivilisation. Deckel drauf, bisschen Chancengleichheit, Mitspracherecht usw. Bis es wieder zu brodeln anfängt.
Das ist doch alles müßig. Das, was der Buddhismus den roten Staub nennt und wo er lachend in seiner eigenen Weltvorstellung sitzt, am Rad der Wiedergeburt drehend. Der eine dreht, der andere wird gedreht, das Ergebnis unterscheidet sich doch nicht sonderlich.
Ich geh mal lieber Fotografieren, meine Art des Adrenalinausstoßens und Klarkommens, kleine Suche nach Schönheit, manchmal nach wilder Schönheit. Nicht nur zur Ablenkung. Nach Sinn dann? Ha, nimm dich nicht so wichtig, meine Liebe. Oder bastel halt an einem Gesellschaftsmodell ? Doppel-Ha?
Beixiaojie, 14.5.2015
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Text 文字

Theoretisch mag ich die Idee des einfach einmal Draufhauens. Nicht nur wie bei Wild Tales mit Grund und aus echtem Es geht nicht Mehr heraus, sondern auch nur so aus Lust an der Sache des Freisetzens von Energien wie bei Fight Club. Aggressionen ein Ventil genehmigen, berechtigterweise oder einer Laune folgend. Den Körper über den Geist siegen lassen, das Archaische über die Zivilisiertheit. Die nett in Reih und Glied hinterm Gartenzaun gepflanzten Blumen ausreißen, den Computer vom Tisch fegen, Fernseher aus dem 10 Stock werfen, jetzt nicht die Frau, das Kind, jemand Schwächeren schlagen, nicht gleich Amok laufen, aber auf all diese Niedlichkeit kotzen. Einmal richtig schön grob sein gegen das Heileweltgeflöte um einen herum.
Bis wirklich wieder einer durchdreht ? sich die Geschichte um eine neue, seine alte Achse dreht.
Ob nun die Unterjochten gegen ihre Unterjocher aufbegehren, wenn etwas hakt, gibt es immer einen Grund, weil es immer Ungerechtigkeit gibt, der entgegenzutreten immer wichtig ist ? ist das der eigentliche Grund? Mir scheint dies ein anderes Thema. Was ist es, das uns nicht zur Ruhe kommen lässt, warum der friedliche Hippietraum nicht funktioniert? Ego, Wahn, Trieb?
Es existieren therapeutische Maßnahmen: Schreien im Wald, Sandsäcke, allgemein führt körperliche Aktivität zum Auspowern. Habe ich auch einmal wieder nötig, ja. Doch ist es nur das? Wenn Körper und Geist nicht im Einklang sind? Oder ist es ein Kitzel, vergleichbar mit und dort in gelenkten Bahnen ausgefochtenem Extremsport?
Auch ich spüre manchmal ein gewisses Aggressionspotential in mir. Oder merke gelegentlich an Reaktionen eines Gegenüber, dass ich zu harsch war.
Ich wollte dem ganzen Theoretisch mag ich die Idee des Draufhauens ein Aber hinzusetzen. Denn ich lese gerade, nicht sonderlich passend als Nachtlektüre, von Joseph Roth Das Spinnennetz, in dem es um den Niedergang der Weimarer Republik geht, Protagonist ist eines dieser halb selbstveropferten, viel mehr aber dumpfen, stumpfen, sich selbst warum auch immer zu wichtig nehmenden Gestalten, die zunächst in sich hineinschreien, dann sich mehr und mehr Rechte herausnehmen. Mir dreht sich beim Lesen alles um. Gestern wollte ich diesem Kerl in seine Eingeweide. Heute will ich mich angeekelt abwenden. Dieses Lauern ? wonach?, diese Bereitschaft ? wozu? Verlangt es nach einem Knall? Hat man einen Knall? Größenwahn, Sucht nach Anerkennung, Minderwertigkeitskomplexe? Böse? Schlimmer: reflektiert böse? Schwarzweiße Kategorien in Ermanglung eines greifbaren Adjektivs.
Also doch lieber Zivilisation. Deckel drauf, bisschen Chancengleichheit, Mitspracherecht usw. Bis es wieder zu brodeln anfängt.
Das ist doch alles müßig. Das, was der Buddhismus den roten Staub nennt und wo er lachend in seiner eigenen Weltvorstellung sitzt, am Rad der Wiedergeburt drehend. Der eine dreht, der andere wird gedreht, das Ergebnis unterscheidet sich doch nicht sonderlich.
Ich geh mal lieber Fotografieren, meine Art des Adrenalinausstoßens und Klarkommens, kleine Suche nach Schönheit, manchmal nach wilder Schönheit. Nicht nur zur Ablenkung. Nach Sinn dann? Ha, nimm dich nicht so wichtig, meine Liebe. Oder bastel halt an einem Gesellschaftsmodell ? Doppel-Ha?
Beixiaojie, 14.5.2015
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Text 文字
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 17. Dezember 2021
Buchempfehlungen: China, Politik 2021
youjia, 11:10h
Meine Chinaliste der Orte und Besorgungen wird länger und länger, meine Reisehoffnungen für 2022 schwinden mehr und mehr. Aber auch wer aktuell nicht nach China reisen kann, kann doch über China lesen. Hier zwei schnelle Buchempfehlungen, gerade noch aus diesem Jahr:
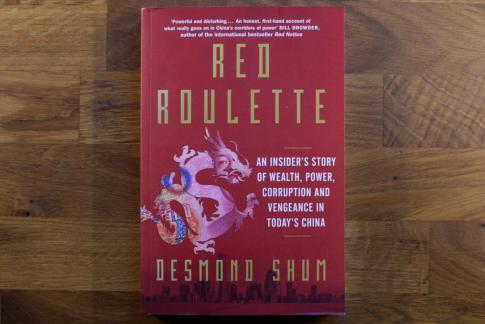
Desmond Shum (2021): Red Roulette: An Insider‘s Story of Wealth, Power, Corruption and Vengeance in Today‘s China. London, Sydney und Neu Delhi: Simon & Schuster.
Die Geschichte eines Insiders, skeptisch und doch voller Erwartung reibt man sich da gleich die Hände. Desmond Shum (Shen Dong 沈栋, *ca. 1969) stammt aus Shanghai, ist in Hongkong aufgewachsen, studierte in den USA, verdiente besonders in den 2000er Jahren und vor allem in Beijing insgesamt umgerechnet 2,5 Milliarden USD (S. 1) und geriet dann mit seiner damaligen Frau Whitney Duan (Duan Weihong 段伟红) in die Fänge von „Macht, Korruption und Rache“.
„Am 5.9.2017 verschwand Whitney Duan im Alter von fünfzig Jahren von den Straßen Beijings“, so beginnt dieses Buch. Dieses Ereignis nimmt Shum zum Anlass, um über sein und Duans Leben zu schreiben und einen in das tiefe, politisch und wirtschaftlich motivierte Machtgeflecht in der Volksrepublik zu ziehen. Ob man Shum seinen gelegentlich durchschimmernden und in Kapitel zwölf dargestellten Philanthropismus nun abnimmt oder das Gewicht doch eher in seiner Partizipation sieht und ihn damit als Enthusiasten des gesellschaftlichen Aufschwungs des Landes oder einfach nur als Opportunisten unter vielen in den 1990er und 2000er Jahren, mag jeder/m selbst überlassen sein. Seine enttäuschten Hoffnungen auf eine offenere, freiere Gesellschaft fußten auf einem weitverbreiteten Optimismus. Das von ihm beschworene Ansinnen, etwas mit Bestand bauen zu wollen, kann eine eigene Hinterlassenschaft beinhalten und gleichzeitig ein guter Bau sein. Wenn man die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht einbezieht, sehe ich als einziges Beispiel seiner vielen Unterfangen die Bibliothek der Qinghua Universität. Immerhin. Auf jeden Fall birgt Shums Geschichte spannende Einsichten.
Die Time berichtete am 13.10.2021 in Why the Ex-Husband of a Missing Chinese Billionaire Is Risking All to Tell Their Story, dass Whitney Duan ihn kurz nach Bekanntgabe der anstehenden Veröffentlichung aus China anrief, um diese zu verhindern. Zumindest weiß er dadurch, dass sie noch lebt.
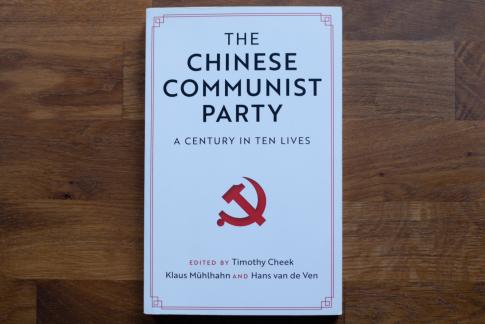
Timothy Cheek, Klaus Mühlhahn und Hans van de Ven (Hgg.) (2021): The Chinese Communist Party: A Century in Ten Lives. Cambridge: Cambridge UP.
Die Kommunistische Partei China (KPCh) feierte dieses Jahr, am 23.7.2021, ihr hundertjähriges Bestehen. In Beijing gab es Militärparaden und Reden, in ganz China wurde die glorreiche Geschichte auf allen Kanälen das gesamte Jahr über aus offizieller und damit gültiger Parteisicht erzählt. In Ausstellungen, Filmen, Fernsehserien, Theaterstücken und Opern, auf Plakatwänden und öffentlichen Bildschirmen, am Himmel und in Blumenteppichen, you name it. Aus nicht nur einer Perspektive lassen die Historiker und Sinologen Cheek et al. zehn Stimmen zu Wort kommen, die das Jahrhundert in ihren einzelnen Jahrzehnten durchschreiten. Jede/r Autor·in schildert ihr oder sein jeweiliges Jahrzehnt anhand einer Person des öffentlichen Lebens aus Politik, Kunst und Kultur oder dem Leben von Intellektuellen. Diese persönlichen Geschichten bilden eine kleine Facette des Lebens mit und unter dem sich aufbauenden Parteiapparat vom anfänglichen Enthusiasmus über den individuellen Aufstieg und Fall, dem Hin und Her zwischen Maßnahmen und Richtungswechseln, in sich aufzeigenden Möglichkeiten und zerschlagenden Hoffnungen, immer aber unter dem schlussendlich schonungslosen Diktat und Machtstreben der Partei. Den einzelnen Kapitel ist jeweils ein kurzer Überblick vorangestellt, der die skizzierte Person in ihr Jahrzehnt einordnet. Besonders gefallen hat mir das Kapitel zu den 1990er Jahren von einem der beiden Historiker dieses Bandes, die in der Volksrepublik tätig sind, Xu Jilin: Wang Yuanhua: A Party Intellectual Reflects. Hier geht es nicht um einen Dissidenten, sondern um eine moderate Stimme, die ihren Weg zu finden sucht.
Etwas älter, aber in diesem Zusammenhang erwähnenswert sind:
– Kai Strittmatter (2018): Die Neuerfindung der Diktatur: Wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. München: Piper.
– Richard McGregor (2013 [2010]): Der rote Apparat: Chinas Kommunisten (Original: The Party. The Secret World of China‘s Communist Rulers). Übs.: Ilse Utz. Berlin: Matthes & Seitz.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Bücher 书籍, Politik 政治, Gegenwart 当代, Beijing 北京

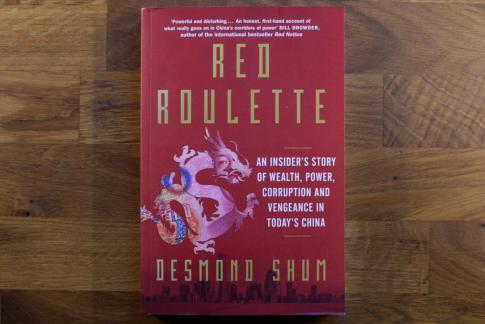
Desmond Shum (2021): Red Roulette: An Insider‘s Story of Wealth, Power, Corruption and Vengeance in Today‘s China. London, Sydney und Neu Delhi: Simon & Schuster.
Die Geschichte eines Insiders, skeptisch und doch voller Erwartung reibt man sich da gleich die Hände. Desmond Shum (Shen Dong 沈栋, *ca. 1969) stammt aus Shanghai, ist in Hongkong aufgewachsen, studierte in den USA, verdiente besonders in den 2000er Jahren und vor allem in Beijing insgesamt umgerechnet 2,5 Milliarden USD (S. 1) und geriet dann mit seiner damaligen Frau Whitney Duan (Duan Weihong 段伟红) in die Fänge von „Macht, Korruption und Rache“.
„Am 5.9.2017 verschwand Whitney Duan im Alter von fünfzig Jahren von den Straßen Beijings“, so beginnt dieses Buch. Dieses Ereignis nimmt Shum zum Anlass, um über sein und Duans Leben zu schreiben und einen in das tiefe, politisch und wirtschaftlich motivierte Machtgeflecht in der Volksrepublik zu ziehen. Ob man Shum seinen gelegentlich durchschimmernden und in Kapitel zwölf dargestellten Philanthropismus nun abnimmt oder das Gewicht doch eher in seiner Partizipation sieht und ihn damit als Enthusiasten des gesellschaftlichen Aufschwungs des Landes oder einfach nur als Opportunisten unter vielen in den 1990er und 2000er Jahren, mag jeder/m selbst überlassen sein. Seine enttäuschten Hoffnungen auf eine offenere, freiere Gesellschaft fußten auf einem weitverbreiteten Optimismus. Das von ihm beschworene Ansinnen, etwas mit Bestand bauen zu wollen, kann eine eigene Hinterlassenschaft beinhalten und gleichzeitig ein guter Bau sein. Wenn man die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht einbezieht, sehe ich als einziges Beispiel seiner vielen Unterfangen die Bibliothek der Qinghua Universität. Immerhin. Auf jeden Fall birgt Shums Geschichte spannende Einsichten.
Die Time berichtete am 13.10.2021 in Why the Ex-Husband of a Missing Chinese Billionaire Is Risking All to Tell Their Story, dass Whitney Duan ihn kurz nach Bekanntgabe der anstehenden Veröffentlichung aus China anrief, um diese zu verhindern. Zumindest weiß er dadurch, dass sie noch lebt.
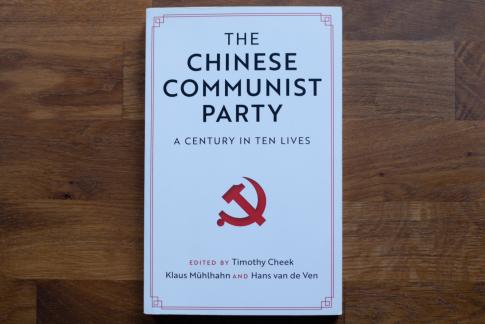
Timothy Cheek, Klaus Mühlhahn und Hans van de Ven (Hgg.) (2021): The Chinese Communist Party: A Century in Ten Lives. Cambridge: Cambridge UP.
Die Kommunistische Partei China (KPCh) feierte dieses Jahr, am 23.7.2021, ihr hundertjähriges Bestehen. In Beijing gab es Militärparaden und Reden, in ganz China wurde die glorreiche Geschichte auf allen Kanälen das gesamte Jahr über aus offizieller und damit gültiger Parteisicht erzählt. In Ausstellungen, Filmen, Fernsehserien, Theaterstücken und Opern, auf Plakatwänden und öffentlichen Bildschirmen, am Himmel und in Blumenteppichen, you name it. Aus nicht nur einer Perspektive lassen die Historiker und Sinologen Cheek et al. zehn Stimmen zu Wort kommen, die das Jahrhundert in ihren einzelnen Jahrzehnten durchschreiten. Jede/r Autor·in schildert ihr oder sein jeweiliges Jahrzehnt anhand einer Person des öffentlichen Lebens aus Politik, Kunst und Kultur oder dem Leben von Intellektuellen. Diese persönlichen Geschichten bilden eine kleine Facette des Lebens mit und unter dem sich aufbauenden Parteiapparat vom anfänglichen Enthusiasmus über den individuellen Aufstieg und Fall, dem Hin und Her zwischen Maßnahmen und Richtungswechseln, in sich aufzeigenden Möglichkeiten und zerschlagenden Hoffnungen, immer aber unter dem schlussendlich schonungslosen Diktat und Machtstreben der Partei. Den einzelnen Kapitel ist jeweils ein kurzer Überblick vorangestellt, der die skizzierte Person in ihr Jahrzehnt einordnet. Besonders gefallen hat mir das Kapitel zu den 1990er Jahren von einem der beiden Historiker dieses Bandes, die in der Volksrepublik tätig sind, Xu Jilin: Wang Yuanhua: A Party Intellectual Reflects. Hier geht es nicht um einen Dissidenten, sondern um eine moderate Stimme, die ihren Weg zu finden sucht.
Etwas älter, aber in diesem Zusammenhang erwähnenswert sind:
– Kai Strittmatter (2018): Die Neuerfindung der Diktatur: Wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. München: Piper.
– Richard McGregor (2013 [2010]): Der rote Apparat: Chinas Kommunisten (Original: The Party. The Secret World of China‘s Communist Rulers). Übs.: Ilse Utz. Berlin: Matthes & Seitz.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Bücher 书籍, Politik 政治, Gegenwart 当代, Beijing 北京
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 13. November 2021
Nord und Süd: Sylt und Allgäu 2021
youjia, 16:32h
In diesem Jahr war ich sehr wenig unterwegs. Hauptsächlich habe ich mich an meinem Schreibtisch aufgehalten, in meiner Wohnung, die ich seit Coronabeginn als woyou shi 卧游室, Kammer des Zuhausebleibenden Umherwandelns, bezeichne. Im September war ich dann aber gleich auf zwei Reisen und endlich einmal wieder ausgeflogen.
Im Norden auf Sylt

Pfeifender Wind, die schnurgerade Horizontlinie stets im Visier, kilometerlange Sandstrände und entsprechend endlose Spaziergänge, Dünen und diese halten zu versuchendes Gestrüpp, Gezeiten, ziemlich salziges Salzwasser mit Brechern, gegen die man sich herrlich werfen, in die man eintauchen, von denen man sich verwirbeln lassen kann. Und das Ganze nur gute drei Stunden in direkter Zugverbindung von Hamburg entfernt.



Der als Überblick von der Uwedüne. Im Flachland werden Höhenmeter mit Kommazahlen angegeben, Erhebungen als Dünen bezeichnet, von 52,5m ist dies der Blick gen Norden, im Hintergrund ist oben die dänische Insel Rømø zu sehen.



Land(wieder)gewinnungsversuche, die links mit Sand saugenden Rohren noch hunderte Meter in die Nordsee hinein weitergingen.
Im Süden im Allgäu







Die Farben wirken hier so unglaubwürdig gesättigt, dass man sie hinterher am Rechner drosselt. Ouh, aber dann kommt Nebel auf …



Neuschwanstein
Meine chinesischen Freund⋅innen waren, wenn in Deutschland, alle schon hier, das Marketing funktioniert in Absprache mit Disney und seinem Logo perfekt. Unter Coronabedingungen ist es zu ertragen, aber die Massenbewältigung mit ihren breiten, abgezäunten Wegen bleibt, ja, verständlich, mache ich in China auch alles mit, aber hierzulande ist es gruselig. Und an Schlössern gibt es in Deutschland bestimmt interessantere und schönere, auch abgesehen von meine vermutlich urdeutsch verklärte Seele reizenderen Ruinengebilden. Man kann sich diesen Pilgergang wirklich schenken. Eigentlich bin ich sogar ein wenig sauer auf mich, dass ich mich habe verlocken lassen. Gut, ich kann hier mal wieder ein bisschen stänkern, ich konnte Kitsch knipsen und habe jetzt die unnötige Gewissheit, dass man nicht jedem Werbegag folgen muss, und natürlich ist es immer nett, mit lieben Menschen einen Tag zu verbringen, aber für letzteres gibt es wahrlich andere Gelegenheiten.

Genau im Bildzentrum findet sich des Schlosses Zipfel, von der niedrigen Auflösung hier zerfressen, aber macht nichts, gleich gehts los.

Ein wenig widersprüchlich ist meine Anzahl der den Ergüssen König Ludwigs Nummer Zwoi von Bayern gewidmeten Bilder. Nichts gegen Exzentrik, deren Betrachtung genieße ich gerne und in vollen Zügen, wenn man mit ihnen nicht Menschen und Geldtöpfe ausgeblutet hat. Aber leider ist dieses Schloss auch rein ästhetisch von innen wie außen ein Reinfall. Ein Bild von meiner Seite hätte allemal gereicht, ein komplettes Verschweigen wäre mehr als gerechtfertigt. Wenn ich Sachen aus meinem Haushalt versehentlich zerstöre, Porzellan zerschlage oder Pflanzen aus unerfindlichen Gründen eingehen lasse, verstöre ich mich damit, sie mir als kleine Mahnmale über Monate hinweg in mein Blickfeld zu stellen. So ähnlich kann wohl die Zurschaustellung der hiesigen Fotos verstanden werden.

War alles gesperrt, diese Brücke genauso wie ein angepriesener Wasserfall in der Nähe. Sah man sich natürlich trotzdem aus der Ferne an, wegen der Anreise und des zugewiesenen Timeslots um 16 Uhr irgendwas.



Doch eine durch Wolken berstende Sonne vertreibt selbst den muffeligsten Graupel am Ende.
--
Reisen benötigen Bücher, hier drei Romanempfehlungen:
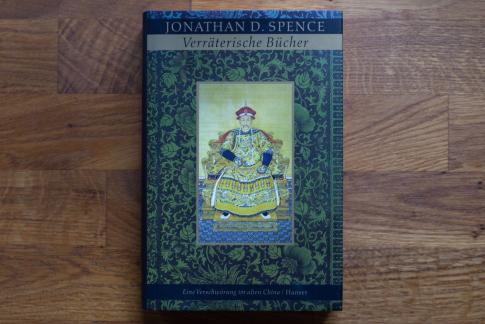
Jonathan D. Spence (2005 [2001]): Verräterische Bücher: Eine Verschwörung im alten China (Original: Treason by the Book). Übs.: Susanne Hornfeck. München und Wien: Hanser.
Literarisch aufgearbeitet liest sich Spence‘ Recherche wie ein Roman. Anhand von Originalquellen verfolgt der altehrwürdige Sinologe und Historiker einen Brief, der einen General Anfang des 18. Jahrhunderts zur Rebellion aufrief. Es entspinnt sich eine Staatsaffäre, die, von einem unbedeutenden Übermittler ausgelöst, tief in die bürokratische Apparatur der Qing-Dynastie führt. Um der eigenen Anklage zu entgehen, muss sich General Yue Zhongqi (1686–1754), ein Nachfahre von Yue Fei (s. Kay unten), dieses Falles annehmen. Beschrieben werden die staatliche Überwachungsmechanismen bis in die hintersten provinziellen Verwaltungseinheiten des Landes, der Aufbau eines Regierungssystems mit Angst und Gehorsamkeit in ihren historisch gewachsenen Ausmaßen mit der steten Gefahr der Verbannung in malariaverseuchte Gebiete. Geboten werden Einblicke in die Komplexität der chinesischen Gesetze bis in ihre Hundertsten Paragraphen hinein, in das Berichtssystem und die Vorschriften des Protokolls zwischen Kaiser Yongzheng (1678–1735) und seinen Magistraten sowie in die Geschwindigkeit der Übermittlung von Botschaften. Thematisiert werden immer wieder ethnische Zugehörigkeiten und die damit einhergehenden Vorbehalte, etwa in der kaiserlichen Abneigung gegenüber Menschen aus Zhejiang, die der Mandschu Yongzheng für „arrogant und boshaft“ hält (S. 38). Es geht um Militärstrategien, um Probleme der Steuereintreibung, um die Überwachung der Moslems in Gansu und die Handhabung gegenüber Vertretern des Dalai Lama. Ein großartiger Fundus!
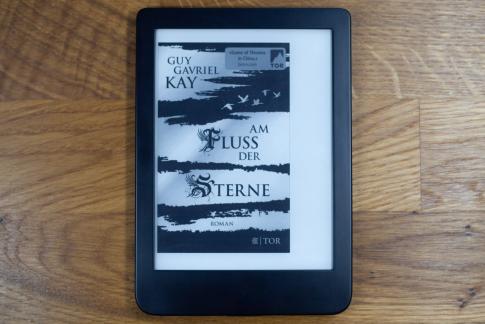
Guy Gavriel Kay (2017 [2013]): Am Fluss der Sterne (Original: River of Stars). Übs.: Ulrike Brauns. Frankfurt: Fischer Tor.
Der zweite Band aus dem fiktiven Reich Kitai ist ans Ende der chinesischen Nördlichen Song-Dynastie (960–1126) verlegt und folgt dem ersten Teil, „Im Schatten des Himmels“ von 2016 (Original: Under Heaven, 2010), der in der Tang-Dynastie bis zur An Lushan-Rebellion (8. Jh.) spielt.
Es geht um die Rückeroberung verlorener Gebiete an die nördlichen Barbaren, die Jurchen, Vorfahren der Mandschus, hier Altai genannt, und schließlich um den Verlust von weit mehr Territorium hin zum Untergang der Nördlichen Song. Mit magisch-fantastischen Elementen allgegenwärtiger Erwähnungen von Geistern, dann der Figur eines Fuchsgeistes, mit den literarischen Anleihen Gesetzloser in den Sumpfgebieten aus dem Shuihu zhuan (auf Deutsch: Die Räuber vom Liangshan-Moor, 14. Jh., spielt um 1120), verknüpft mit der Geschichte des historischen Heerführers Yue Fei (1103–1142), besticht Kay mit etlichen überlieferten Referenzen. Dabei kommt er angenehmerweise ganz ohne Erklärungen aus. Es geht um Hofintrigen von Ministern und Eunuchen, um Verbannungen von Dichtern und Gelehrten. Der Aberglauben von Kaiser Huizong, der hier Wenzong heißt, und der verbreitete Geisterglaube werden nie ins Lächerliche gezogen, sondern als zu jener Zeit selbstverständlich dargestellt. Den Beschreibungen beispielsweise von Kaiser Huizongs Vorlieben der Kunst vor seinen Staatsgeschäften, von seinem kalligrafischen Stil des schlanken Goldes, seines Gartenbaus und daoistischen Umgangs mit Konkubinen, der Vermessung seiner Handlänge für Musikreformen und ihrer Aufnahme durch seine Untertanen fehlt es dabei nicht an Witz, selbst wenn man die Bezüge nicht kennt oder einem etliche entgehen. Gerade gegen Ende wird die wiederholte Erwähnung des Verfahrens von Geschichtsschreibern etwas ermüdend. Aber es ist ein wunderbar kurzweiliges Vergnügen, von Action bis Romance ist hier alles enthalten, was einen Hollywood-Blockbuster ausmacht.
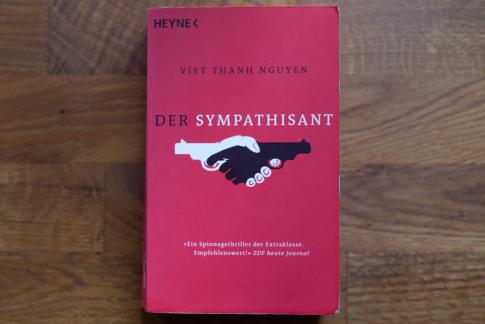
Viet Thanh Nguyen (2017 [2015]): Der Sympathisant (Original: The Sympathizer). Übs.: Wolfgang Müller. München: Blessing.
Einer der besten Romane, die ich seit langem gelesen habe. Mit diesem, seinem ersten Roman erhielt der vietnamesisch-US-amerikanische Schriftsteller Nguyen 2016 wohlverdient den Pulitzer-Preis für Belletristik.
Die Hauptthemen dieses Werkes, der Vietnamkrieg und die US-Migration in der selten dargelegten vietnamesische Perspektive, wären wohl kaum zu ertragen, wenn die Hauptfigur besonders in ihren nebensächlichen Anmerkungen nicht so unglaublich witzig wäre, um nicht zu sagen sympathisch. Wobei hier mit Sympathien die für den Kommunismus gemeint sind, als Sympathisanten bezeichnet sich der unzuverlässige Erzähler selbst, weil er mit zwei Perspektiven sehen kann. Die Verlagsbeschreibung des Romans als Politthriller, Spionageroman, historisches Kriegsdrama, politische Migrantengeschichte, im Englischen noch als Metafiktion, gibt sich ziemlich übertrieben. Und doch ist es all dies. Es handelt sich um die anonymen Aufzeichnungen eines erzwungenen Geständnisses von einem politischen Gefangenen, einem nordvietnamesisch-kommunistischen Spion in der südvietnamesischen Armee, der in der südvietnamesischen Exilgemeinde in Los Angeles landet. In rasantem Tempo erzählt der darüber hinaus noch mit der Problematik eines französischen katholischen Priesters als Vater beglückte Protagonist von seinen Erlebnissen seit dem Fall von Saigon 1975 und kommentiert diese Ereignisse unverfroren ehrlich in ihren politischen und in seinen persönlichen Widersprüchen. Die eindimensionale amerikanische Sicht auf den Vietnamkrieg wird etwa besonders deutlich in einem Nebenjob der Hauptfigur als Vermittler für einen amerikanischen Film zu diesem Thema beschrieben. Die Fortsetzung ist bestellt: Die Idealisten (Original: The Committed), beide 2021.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Reise 专程, Landschaft 山水, Architektur 建筑, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bücher 书籍

Im Norden auf Sylt

Pfeifender Wind, die schnurgerade Horizontlinie stets im Visier, kilometerlange Sandstrände und entsprechend endlose Spaziergänge, Dünen und diese halten zu versuchendes Gestrüpp, Gezeiten, ziemlich salziges Salzwasser mit Brechern, gegen die man sich herrlich werfen, in die man eintauchen, von denen man sich verwirbeln lassen kann. Und das Ganze nur gute drei Stunden in direkter Zugverbindung von Hamburg entfernt.



Der als Überblick von der Uwedüne. Im Flachland werden Höhenmeter mit Kommazahlen angegeben, Erhebungen als Dünen bezeichnet, von 52,5m ist dies der Blick gen Norden, im Hintergrund ist oben die dänische Insel Rømø zu sehen.



Land(wieder)gewinnungsversuche, die links mit Sand saugenden Rohren noch hunderte Meter in die Nordsee hinein weitergingen.
Im Süden im Allgäu







Die Farben wirken hier so unglaubwürdig gesättigt, dass man sie hinterher am Rechner drosselt. Ouh, aber dann kommt Nebel auf …



Neuschwanstein
Meine chinesischen Freund⋅innen waren, wenn in Deutschland, alle schon hier, das Marketing funktioniert in Absprache mit Disney und seinem Logo perfekt. Unter Coronabedingungen ist es zu ertragen, aber die Massenbewältigung mit ihren breiten, abgezäunten Wegen bleibt, ja, verständlich, mache ich in China auch alles mit, aber hierzulande ist es gruselig. Und an Schlössern gibt es in Deutschland bestimmt interessantere und schönere, auch abgesehen von meine vermutlich urdeutsch verklärte Seele reizenderen Ruinengebilden. Man kann sich diesen Pilgergang wirklich schenken. Eigentlich bin ich sogar ein wenig sauer auf mich, dass ich mich habe verlocken lassen. Gut, ich kann hier mal wieder ein bisschen stänkern, ich konnte Kitsch knipsen und habe jetzt die unnötige Gewissheit, dass man nicht jedem Werbegag folgen muss, und natürlich ist es immer nett, mit lieben Menschen einen Tag zu verbringen, aber für letzteres gibt es wahrlich andere Gelegenheiten.

Genau im Bildzentrum findet sich des Schlosses Zipfel, von der niedrigen Auflösung hier zerfressen, aber macht nichts, gleich gehts los.

Ein wenig widersprüchlich ist meine Anzahl der den Ergüssen König Ludwigs Nummer Zwoi von Bayern gewidmeten Bilder. Nichts gegen Exzentrik, deren Betrachtung genieße ich gerne und in vollen Zügen, wenn man mit ihnen nicht Menschen und Geldtöpfe ausgeblutet hat. Aber leider ist dieses Schloss auch rein ästhetisch von innen wie außen ein Reinfall. Ein Bild von meiner Seite hätte allemal gereicht, ein komplettes Verschweigen wäre mehr als gerechtfertigt. Wenn ich Sachen aus meinem Haushalt versehentlich zerstöre, Porzellan zerschlage oder Pflanzen aus unerfindlichen Gründen eingehen lasse, verstöre ich mich damit, sie mir als kleine Mahnmale über Monate hinweg in mein Blickfeld zu stellen. So ähnlich kann wohl die Zurschaustellung der hiesigen Fotos verstanden werden.

War alles gesperrt, diese Brücke genauso wie ein angepriesener Wasserfall in der Nähe. Sah man sich natürlich trotzdem aus der Ferne an, wegen der Anreise und des zugewiesenen Timeslots um 16 Uhr irgendwas.



Doch eine durch Wolken berstende Sonne vertreibt selbst den muffeligsten Graupel am Ende.
--
Reisen benötigen Bücher, hier drei Romanempfehlungen:
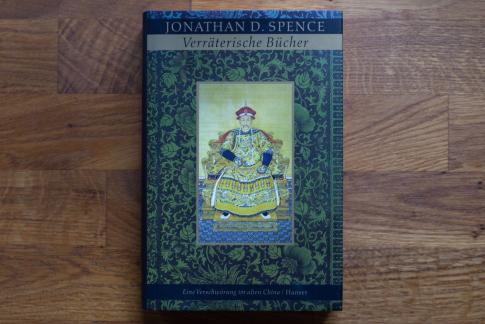
Jonathan D. Spence (2005 [2001]): Verräterische Bücher: Eine Verschwörung im alten China (Original: Treason by the Book). Übs.: Susanne Hornfeck. München und Wien: Hanser.
Literarisch aufgearbeitet liest sich Spence‘ Recherche wie ein Roman. Anhand von Originalquellen verfolgt der altehrwürdige Sinologe und Historiker einen Brief, der einen General Anfang des 18. Jahrhunderts zur Rebellion aufrief. Es entspinnt sich eine Staatsaffäre, die, von einem unbedeutenden Übermittler ausgelöst, tief in die bürokratische Apparatur der Qing-Dynastie führt. Um der eigenen Anklage zu entgehen, muss sich General Yue Zhongqi (1686–1754), ein Nachfahre von Yue Fei (s. Kay unten), dieses Falles annehmen. Beschrieben werden die staatliche Überwachungsmechanismen bis in die hintersten provinziellen Verwaltungseinheiten des Landes, der Aufbau eines Regierungssystems mit Angst und Gehorsamkeit in ihren historisch gewachsenen Ausmaßen mit der steten Gefahr der Verbannung in malariaverseuchte Gebiete. Geboten werden Einblicke in die Komplexität der chinesischen Gesetze bis in ihre Hundertsten Paragraphen hinein, in das Berichtssystem und die Vorschriften des Protokolls zwischen Kaiser Yongzheng (1678–1735) und seinen Magistraten sowie in die Geschwindigkeit der Übermittlung von Botschaften. Thematisiert werden immer wieder ethnische Zugehörigkeiten und die damit einhergehenden Vorbehalte, etwa in der kaiserlichen Abneigung gegenüber Menschen aus Zhejiang, die der Mandschu Yongzheng für „arrogant und boshaft“ hält (S. 38). Es geht um Militärstrategien, um Probleme der Steuereintreibung, um die Überwachung der Moslems in Gansu und die Handhabung gegenüber Vertretern des Dalai Lama. Ein großartiger Fundus!
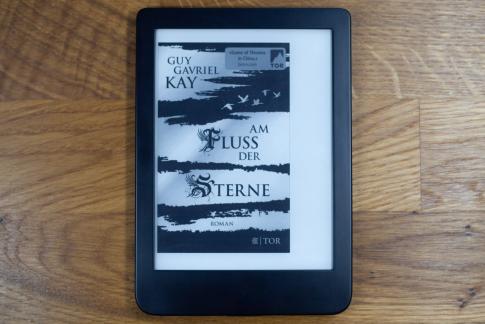
Guy Gavriel Kay (2017 [2013]): Am Fluss der Sterne (Original: River of Stars). Übs.: Ulrike Brauns. Frankfurt: Fischer Tor.
Der zweite Band aus dem fiktiven Reich Kitai ist ans Ende der chinesischen Nördlichen Song-Dynastie (960–1126) verlegt und folgt dem ersten Teil, „Im Schatten des Himmels“ von 2016 (Original: Under Heaven, 2010), der in der Tang-Dynastie bis zur An Lushan-Rebellion (8. Jh.) spielt.
Es geht um die Rückeroberung verlorener Gebiete an die nördlichen Barbaren, die Jurchen, Vorfahren der Mandschus, hier Altai genannt, und schließlich um den Verlust von weit mehr Territorium hin zum Untergang der Nördlichen Song. Mit magisch-fantastischen Elementen allgegenwärtiger Erwähnungen von Geistern, dann der Figur eines Fuchsgeistes, mit den literarischen Anleihen Gesetzloser in den Sumpfgebieten aus dem Shuihu zhuan (auf Deutsch: Die Räuber vom Liangshan-Moor, 14. Jh., spielt um 1120), verknüpft mit der Geschichte des historischen Heerführers Yue Fei (1103–1142), besticht Kay mit etlichen überlieferten Referenzen. Dabei kommt er angenehmerweise ganz ohne Erklärungen aus. Es geht um Hofintrigen von Ministern und Eunuchen, um Verbannungen von Dichtern und Gelehrten. Der Aberglauben von Kaiser Huizong, der hier Wenzong heißt, und der verbreitete Geisterglaube werden nie ins Lächerliche gezogen, sondern als zu jener Zeit selbstverständlich dargestellt. Den Beschreibungen beispielsweise von Kaiser Huizongs Vorlieben der Kunst vor seinen Staatsgeschäften, von seinem kalligrafischen Stil des schlanken Goldes, seines Gartenbaus und daoistischen Umgangs mit Konkubinen, der Vermessung seiner Handlänge für Musikreformen und ihrer Aufnahme durch seine Untertanen fehlt es dabei nicht an Witz, selbst wenn man die Bezüge nicht kennt oder einem etliche entgehen. Gerade gegen Ende wird die wiederholte Erwähnung des Verfahrens von Geschichtsschreibern etwas ermüdend. Aber es ist ein wunderbar kurzweiliges Vergnügen, von Action bis Romance ist hier alles enthalten, was einen Hollywood-Blockbuster ausmacht.
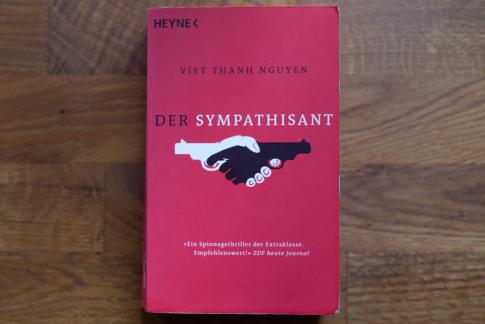
Viet Thanh Nguyen (2017 [2015]): Der Sympathisant (Original: The Sympathizer). Übs.: Wolfgang Müller. München: Blessing.
Einer der besten Romane, die ich seit langem gelesen habe. Mit diesem, seinem ersten Roman erhielt der vietnamesisch-US-amerikanische Schriftsteller Nguyen 2016 wohlverdient den Pulitzer-Preis für Belletristik.
Die Hauptthemen dieses Werkes, der Vietnamkrieg und die US-Migration in der selten dargelegten vietnamesische Perspektive, wären wohl kaum zu ertragen, wenn die Hauptfigur besonders in ihren nebensächlichen Anmerkungen nicht so unglaublich witzig wäre, um nicht zu sagen sympathisch. Wobei hier mit Sympathien die für den Kommunismus gemeint sind, als Sympathisanten bezeichnet sich der unzuverlässige Erzähler selbst, weil er mit zwei Perspektiven sehen kann. Die Verlagsbeschreibung des Romans als Politthriller, Spionageroman, historisches Kriegsdrama, politische Migrantengeschichte, im Englischen noch als Metafiktion, gibt sich ziemlich übertrieben. Und doch ist es all dies. Es handelt sich um die anonymen Aufzeichnungen eines erzwungenen Geständnisses von einem politischen Gefangenen, einem nordvietnamesisch-kommunistischen Spion in der südvietnamesischen Armee, der in der südvietnamesischen Exilgemeinde in Los Angeles landet. In rasantem Tempo erzählt der darüber hinaus noch mit der Problematik eines französischen katholischen Priesters als Vater beglückte Protagonist von seinen Erlebnissen seit dem Fall von Saigon 1975 und kommentiert diese Ereignisse unverfroren ehrlich in ihren politischen und in seinen persönlichen Widersprüchen. Die eindimensionale amerikanische Sicht auf den Vietnamkrieg wird etwa besonders deutlich in einem Nebenjob der Hauptfigur als Vermittler für einen amerikanischen Film zu diesem Thema beschrieben. Die Fortsetzung ist bestellt: Die Idealisten (Original: The Committed), beide 2021.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Reise 专程, Landschaft 山水, Architektur 建筑, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bücher 书籍
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 12. November 2021
Hamburg: Unterwegs 2021
youjia, 19:51h
Was treibt man eigentlich so, wenn man hinaus möchte und sich weiterhin ein wenig im Sozialisierungsschockzustand suhlt?
Freiluftmusik

Musik ist nicht so mein Ding, aber die Ankündigung von Freiluftmusik, besonders die eines Orchesters auf einer Hochhaussiedlung hörte sich interessant an. Einen schönen Titel gab es dazu, es spielten die Dresdner Sinfoniker: Himmel über Hamburg, organisiert von Kampnagel und der Elbphilharmonie, auf den Hochhäusern in der Lenzsiedlung, Eimsbüttel, 17.7.2021.
Es war beeindruckend, was ein Aufwand getrieben wurde, kilometerlange Kabeltrassen wanden sich die Plattenbauten hoch, jedem Musiker standen Rigger und sonst nicht welche Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Das Ganze fand auf dem wiederum verkabelten Sportplatz davor statt – der mit Granulat unterfütterte Plastikrasen tat schon vom Hinsehen weh, hier kann man sich als Siedlungskind nur schreiende Knieverbrennungen abholen, dass so etwas noch erlaubt ist? Musikalisch kann ich nur mit Laienunverständnis herangehen. Tatsächlich war es wohl egal, dass über einem gespielt wurde. Alle Töne liefen über je Musiker⋅in ein Mikro in ein Mischpult, das diese aufeinander abgestimmt in die unten aufgestellten Boxen übertrug. Das fand ich doch etwas schade. Natürlich ist jeder Ton je nach Entfernung unterschiedlich lang und je nach Windrichtung unterschiedlich wirr unterwegs, Gleichzeitigkeit würde ein Chaos verursachen. Ich hatte mir dennoch eher etwas wie ein Gipfelduett mit Ansprache, Hall, Horchen, Antwort vorgestellt. Gut gefallen haben mir die chinesischen Trommler⋅innen auf dem Sportplatz, die ebenfalls in ihre Mikros wummerten, aber deren Echos zusätzlich von den Platten zu einem herüberschwangen. Die wohl für das Berggefühl gewählten Alphörner versuchten ähnliches, einige unten auf dem Platz, andere oben auf den Häusern. Ich muss gestehen, dass ich zuvor noch keine Alphörner gehört hatte. Schon merkwürdig, klangen die nur in meinen Ohren wie Sirenen, so wie ich mir die Fabelwesengeräusche vorstelle, oder teils wie Unterwassertiere, wie diffuse Wahlklänge? Definitiv nicht so meins. Auch die sonst ausgewählten Stücke waren für meinen Geschmack etwas grotesk ausgewählt, ich würde sie als barocke Marschmusik bezeichnen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik. Immerhin stimmte das Wetter.


Freiluftkino

Freiluft ist schon eine gute Corona-Maßnahme. Wie letztes Jahr fanden auch in diesem Openair-Kinoschauen statt, etwa das OpenAir Kino, veranstaltet vom Filmraum, im Stadtpark Eimsbüttel, 1.7.–4.9.2021, oder die Filmnächte, vom 3001, im Schanzenpark, 9.–25.7.2021.
Auf Alles ist eins. Außer der 0., der Doku über den CCC, hatte ich mich sehr gefreut. Ich weiß es nicht, vielleicht lag es an der langen Kulturpause, vielleicht waren meine Erwartungen dadurch übermäßig überhöht. Dachte ich doch, auch alle anderen hätten so lange nichts zeigen wie ich sehen können. Und weiß ich doch gleichzeitig, dass es immer nur gelegentliche Perlen zu entdecken gibt (auch wenn ich an objektive Kunstwertigkeit glaube, meinetwegen gerne mit subjektiven Tendenzen). Diesen Film empfand ich wie die Himmelsklänge über den Platten leider als eher enttäuschend. Klar, es gab den einen oder anderen Lacher, einige neue Informationen, der Film war auch ganz gut zusammengeschnitten mit altem Doku- und aktuellem Interviewmaterial, die Katze durchs Bild als Schrödingers, meinetwegen. Aber mir war er zu langatmig und mit Vanessa stimme ich überein, dass sich die Regisseure ruhig auf die Anfänge hätten beschränken können. Die Jahre nach 2000 wurden am Ende auf die Schnelle abgehakt, noch kurz dazugepresst und dadurch vielmehr marginalisiert. Ein zweiter Teil wäre auch in Ordnung gewesen, der Fokus auf Gründungslegende Wau Holland hätte nach seinem Tod 2001 gut enden können. Außerdem war es wahrlich gruselig zu sehen, wie wenig Frauen auftauchten. Ich erinnere mich nur noch an die fraglos großartige Constanze Kurz, aber das kann doch nicht alles sein.
Nostalgie: Blaues Wunder

Die Cremonbrücke, auch „das blaue Wunder“ genannt, über die Willy-Brandt-Straße, ganz in der Nähe des chinesischen Visa-Servicebüros, wurde inzwischen (Ende Oktober 2021) abgerissen. Im Endeffekt stand sie neuen Immobilien im Wege, die Barrierefreiheit mit ständig defekten, wartungsintensiven Außenrolltreppen musste als Argument herhalten. Ich mochte sie.

HafenCity

Joiri Minaya: Die Verhüllung. Intervention an der Kornhausbrücke beim Zollkanal gen HafenCity, 4.6.–30.9.2021.
Auf den Brückenpfeilern sind normalerweise die Statuen von Kolumbus und Vasco da Gama zu sehen. Für das Stadtentwicklungsprojekts „Imagine the City“ wurden im Sommer 2021 16 Künstler⋅innen eingeladen.
Jungfernstieg: U1

Noch frisch und neu blinkt es, von chinesischen Restaurants wissen wir, dass Spiegel an den Wänden besonders gerne schmale Räume optisch vergrößern. Das Design stammt von WRS, ich finde es für die Ecke Hamburgs passend. Ob das empfindliche Schwarz und Weiß die beste Wahl sind, mag im nächsten Jahr bewertet werden. Achja, und der Jungfernstieg wurde/ wird ja auch neugestaltet, attraktiver, autofrei, die Perspektiven gehen auseinander – mir gefällt es radelnd.

Ewig schon möchte ich nach Moskau, um mir dort die alten U-Bahnstationen anzusehen. Irgendwann einmal.
Prismatischer Blick: Alter Wall

Zu Olafur Eliasson habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Sein physikalischer Ansatz der Arbeiten etwa in seiner Ausstellung 2018 im Red Brick Art Museum 红砖美术馆 ist umwerfend. Dann wieder gibt es Lächerlichkeiten bis Monstrositäten von Pseudo-Gutmenschentum wie seine Show in der Fondation Beyerler, die Farbe in Wasser kippen, um – ist richtig – auf Verschmutzung aufmerksam machen zu wollen, oder wie seine Little Sun-Solarlampen, die Afrika mit Plastikschrott zumüllen. Naja, auf jeden Fall hat ihm der Alte Wall in Hamburg bestimmt einiges mehr in die Kassen gespült für seinen sogenannten „Gesellschaftsspiegel“. Die angedeutete Gesellschaftskritik im Titel kann man sich getrost schenken, da kann ich ihn tatsächlich nicht ernstnehmen. In die beiden Säulen, eine vorne am Rathausmarkt Nähe Bucerius Kunst Forum, eine hinten weiter die Straße hoch, kann man trotzdem einmal hochschauen.
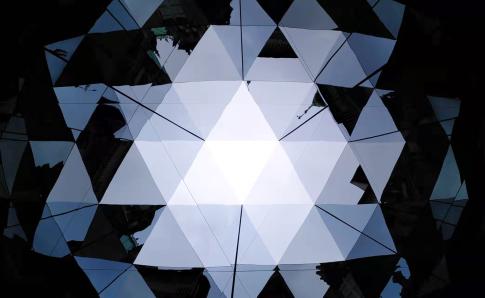
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Hamburg 汉堡, Unterwegs 路上, Architektur 建筑, Film 电影, Musik 音乐, Gegenwart 当代

Freiluftmusik

Musik ist nicht so mein Ding, aber die Ankündigung von Freiluftmusik, besonders die eines Orchesters auf einer Hochhaussiedlung hörte sich interessant an. Einen schönen Titel gab es dazu, es spielten die Dresdner Sinfoniker: Himmel über Hamburg, organisiert von Kampnagel und der Elbphilharmonie, auf den Hochhäusern in der Lenzsiedlung, Eimsbüttel, 17.7.2021.
Es war beeindruckend, was ein Aufwand getrieben wurde, kilometerlange Kabeltrassen wanden sich die Plattenbauten hoch, jedem Musiker standen Rigger und sonst nicht welche Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Das Ganze fand auf dem wiederum verkabelten Sportplatz davor statt – der mit Granulat unterfütterte Plastikrasen tat schon vom Hinsehen weh, hier kann man sich als Siedlungskind nur schreiende Knieverbrennungen abholen, dass so etwas noch erlaubt ist? Musikalisch kann ich nur mit Laienunverständnis herangehen. Tatsächlich war es wohl egal, dass über einem gespielt wurde. Alle Töne liefen über je Musiker⋅in ein Mikro in ein Mischpult, das diese aufeinander abgestimmt in die unten aufgestellten Boxen übertrug. Das fand ich doch etwas schade. Natürlich ist jeder Ton je nach Entfernung unterschiedlich lang und je nach Windrichtung unterschiedlich wirr unterwegs, Gleichzeitigkeit würde ein Chaos verursachen. Ich hatte mir dennoch eher etwas wie ein Gipfelduett mit Ansprache, Hall, Horchen, Antwort vorgestellt. Gut gefallen haben mir die chinesischen Trommler⋅innen auf dem Sportplatz, die ebenfalls in ihre Mikros wummerten, aber deren Echos zusätzlich von den Platten zu einem herüberschwangen. Die wohl für das Berggefühl gewählten Alphörner versuchten ähnliches, einige unten auf dem Platz, andere oben auf den Häusern. Ich muss gestehen, dass ich zuvor noch keine Alphörner gehört hatte. Schon merkwürdig, klangen die nur in meinen Ohren wie Sirenen, so wie ich mir die Fabelwesengeräusche vorstelle, oder teils wie Unterwassertiere, wie diffuse Wahlklänge? Definitiv nicht so meins. Auch die sonst ausgewählten Stücke waren für meinen Geschmack etwas grotesk ausgewählt, ich würde sie als barocke Marschmusik bezeichnen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik. Immerhin stimmte das Wetter.


Freiluftkino

Freiluft ist schon eine gute Corona-Maßnahme. Wie letztes Jahr fanden auch in diesem Openair-Kinoschauen statt, etwa das OpenAir Kino, veranstaltet vom Filmraum, im Stadtpark Eimsbüttel, 1.7.–4.9.2021, oder die Filmnächte, vom 3001, im Schanzenpark, 9.–25.7.2021.
Auf Alles ist eins. Außer der 0., der Doku über den CCC, hatte ich mich sehr gefreut. Ich weiß es nicht, vielleicht lag es an der langen Kulturpause, vielleicht waren meine Erwartungen dadurch übermäßig überhöht. Dachte ich doch, auch alle anderen hätten so lange nichts zeigen wie ich sehen können. Und weiß ich doch gleichzeitig, dass es immer nur gelegentliche Perlen zu entdecken gibt (auch wenn ich an objektive Kunstwertigkeit glaube, meinetwegen gerne mit subjektiven Tendenzen). Diesen Film empfand ich wie die Himmelsklänge über den Platten leider als eher enttäuschend. Klar, es gab den einen oder anderen Lacher, einige neue Informationen, der Film war auch ganz gut zusammengeschnitten mit altem Doku- und aktuellem Interviewmaterial, die Katze durchs Bild als Schrödingers, meinetwegen. Aber mir war er zu langatmig und mit Vanessa stimme ich überein, dass sich die Regisseure ruhig auf die Anfänge hätten beschränken können. Die Jahre nach 2000 wurden am Ende auf die Schnelle abgehakt, noch kurz dazugepresst und dadurch vielmehr marginalisiert. Ein zweiter Teil wäre auch in Ordnung gewesen, der Fokus auf Gründungslegende Wau Holland hätte nach seinem Tod 2001 gut enden können. Außerdem war es wahrlich gruselig zu sehen, wie wenig Frauen auftauchten. Ich erinnere mich nur noch an die fraglos großartige Constanze Kurz, aber das kann doch nicht alles sein.
Nostalgie: Blaues Wunder

Die Cremonbrücke, auch „das blaue Wunder“ genannt, über die Willy-Brandt-Straße, ganz in der Nähe des chinesischen Visa-Servicebüros, wurde inzwischen (Ende Oktober 2021) abgerissen. Im Endeffekt stand sie neuen Immobilien im Wege, die Barrierefreiheit mit ständig defekten, wartungsintensiven Außenrolltreppen musste als Argument herhalten. Ich mochte sie.

HafenCity

Joiri Minaya: Die Verhüllung. Intervention an der Kornhausbrücke beim Zollkanal gen HafenCity, 4.6.–30.9.2021.
Auf den Brückenpfeilern sind normalerweise die Statuen von Kolumbus und Vasco da Gama zu sehen. Für das Stadtentwicklungsprojekts „Imagine the City“ wurden im Sommer 2021 16 Künstler⋅innen eingeladen.
Jungfernstieg: U1

Noch frisch und neu blinkt es, von chinesischen Restaurants wissen wir, dass Spiegel an den Wänden besonders gerne schmale Räume optisch vergrößern. Das Design stammt von WRS, ich finde es für die Ecke Hamburgs passend. Ob das empfindliche Schwarz und Weiß die beste Wahl sind, mag im nächsten Jahr bewertet werden. Achja, und der Jungfernstieg wurde/ wird ja auch neugestaltet, attraktiver, autofrei, die Perspektiven gehen auseinander – mir gefällt es radelnd.

Ewig schon möchte ich nach Moskau, um mir dort die alten U-Bahnstationen anzusehen. Irgendwann einmal.
Prismatischer Blick: Alter Wall

Zu Olafur Eliasson habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Sein physikalischer Ansatz der Arbeiten etwa in seiner Ausstellung 2018 im Red Brick Art Museum 红砖美术馆 ist umwerfend. Dann wieder gibt es Lächerlichkeiten bis Monstrositäten von Pseudo-Gutmenschentum wie seine Show in der Fondation Beyerler, die Farbe in Wasser kippen, um – ist richtig – auf Verschmutzung aufmerksam machen zu wollen, oder wie seine Little Sun-Solarlampen, die Afrika mit Plastikschrott zumüllen. Naja, auf jeden Fall hat ihm der Alte Wall in Hamburg bestimmt einiges mehr in die Kassen gespült für seinen sogenannten „Gesellschaftsspiegel“. Die angedeutete Gesellschaftskritik im Titel kann man sich getrost schenken, da kann ich ihn tatsächlich nicht ernstnehmen. In die beiden Säulen, eine vorne am Rathausmarkt Nähe Bucerius Kunst Forum, eine hinten weiter die Straße hoch, kann man trotzdem einmal hochschauen.
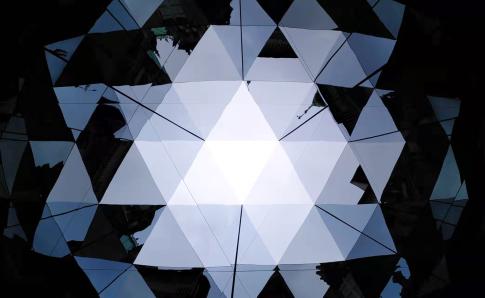
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Hamburg 汉堡, Unterwegs 路上, Architektur 建筑, Film 电影, Musik 音乐, Gegenwart 当代
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 15. Juni 2021
Buchempfehlungen: China, Gegenwartskunst
youjia, 19:30h
Weiterhin bin ich etwas zaghaft öffentlich unterwegs. Um aber endlich wieder einmal etwas zu posten, stelle ich hier den Teil meiner Lockdown-Lektüre vor, der sich mit Gegenwartskunst in China beschäftigt. Es handelt sich um deutsch- oder englischsprachige Werke und um Übersetzungen. Dazu streife ich den einen oder anderen Randbereich. Die Reihenfolge ist alphabetisch nach Autor:innen geordnet, unterteilt in zunächst die Sachbücher und unten zusätzlich ein paar Romane.
Diese Liste ist natürlich längst nicht als erschöpfend, sondern als (relativ oder immer noch) aktuelle Auswahl zu begreifen.
Sachbücher: Kunst in China
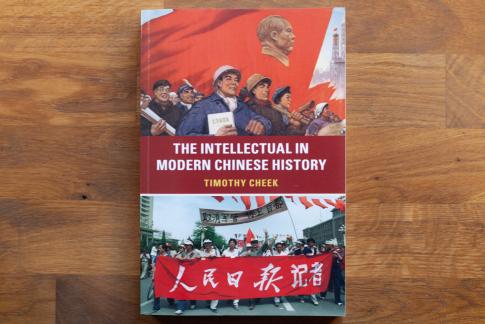
Cheek, Timothy (2015): The Intellectual in Modern Chinese History. Cambridge: Cambridge UP.
Dem Alphabet folgend, beginnt diese Liste mit einem der Randbereiche für die Gegenwartskunst in China, mit den chronologisch beschriebenen Diskursen der Intellektuellen von 1895 bis 2015, von der Niederlage im Sino-japanischen Krieg bis zum Aufschwung im Zuge der Olympischen Spiele 2008 und ihren Nachklängen. Cheeks Inhaltsverzeichnis ist sehr aussagekräftig, weshalb ich es hier wiedergebe. In Zwanzigjahresschritten sind stets ein Umbruch und ein Motto genannt, die sich auf die politische Situation beziehen. Cheek beginnt mit China in den 1910er Jahren: „Reform: making China fit the world“, die 1930er nennt er: „Revolution: awakening New China“, die 1950er: „Rejuvenation: organizing China“, die 1970er: „Revolutionary revival: overthrowing the lords of nation-building“, die 1990er: „Reviving reform: correcting revolutionary errors“ und endet mit den 2010er Jahren: „Rejuvenation: securing the Chinese Dream“. Die Darstellung folgt den wichtigsten Protagonisten, ihren Ideen und Begrifflichkeiten sowie ihren Ansätzen und Aktionen auf Grundlage der politischen Lage.
Für den Anschluss an diese Abhandlung möchte ich gerne auf Minzners unten empfohlenes Werk „End of an Era“ verweisen.
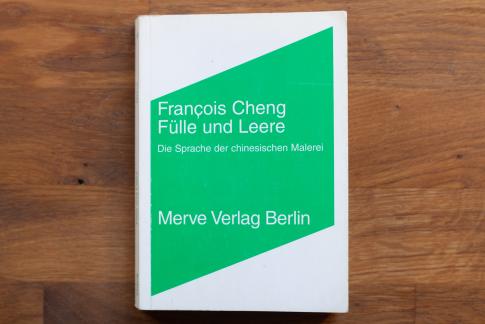
Cheng, François (2004 [1991]): Fülle und Leere. Die Sprache der chinesischen Malerei (Original: Vide et plein. Le langage pictural chinois). Berlin: Merve.
Chengs „Fülle und Leere“ ist hier, genauso wie Lis „Path of Beauty“ und Zhus „Philosophie der chinesischen Kunst“, als Ergänzung zum Verständnis der Gegenwartskunst aufgenommen.
Bei Cheng geht es um den bis heute wichtigen traditionellen Begriff der Leere im Verhältnis von Mensch und Universum als Theorie in der chinesischen Philosophie und als praktische Anwendung in der Malerei. Nach einer Einführung von der Tang- bis zur Qing-Dynastie werden das grundlegende Konzept der Leere und die grundlegenden Begriffe der traditionellen chinesischen Malerei vorgestellt. Mit anschaulichen Bildbeispielen werden die verschiedenen Pinselführungen genauso beschrieben wie Form und Volumen, Verhältnis und Proportion und die drei Perspektiven der Malerei. Es folgt eine Zusammenfassung der Fachbegriffe der verschiedenen Ebenen: „Pinsel-Tusche“, „Dunkel-Hell“, „Berg-Wasser“, „Mensch-Himmel“ und „Die fünfte Dimension“, also die Leerheit (S. 126–132). Das letzte Viertel des kleinformatigen, 180 Seiten umfassenden Buches ist beispielhaft der Malerei von Shi Tao 石涛 (ca. 1641– ca. 1707) aus Wuzhou, Guangxi gewidmet.
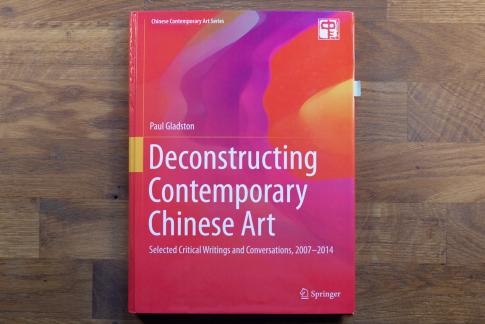
Gladston, Paul (2016): Deconstructing Contemporary Chinese Art: Selected Critical Writings and Conversations, 2007–2014. Berlin und Heidelberg: Springer.
Ganz witzig finde ich, dass diese Ausgabe das Format meines alten Diercke Weltatlas hat, leider fällt dieses Buch im Gegensatz zum Diercke schnell auseinander. Es handelt sich um eine Ausgabe der „Chinese Contemporary Art Series“, von 2015 bis heute, der China Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing, in der der Australier Paul Gladston die stellvertretende Chefredaktion innehat. Nach Gladstons „Contemporary Chinese Art: A Critical History“, London: Reaktion Books 2014, sowie etlichen anderen Büchern und Artikeln aus seiner Feder, handelt es sich hier um eine Zusammenstellung verschiedener seiner Schriften, Gespräche und Ausstellungsbeschreibungen zwischen 2007 und 2014 und basiert insbesondere auf seinem Aufenthalt in China 2005–2010. Dargestellt wird die chinesische und internationale Entwicklung der Gegenwartskunst in China. Dies geschieht etwa unter Aspekten der Modernität und Tradition, der kuratorischen Praxis und der internationalen Problematik der Deterritorialisierung von Identitätsausstellungen, der Avantgardekunst, der kulturellen Übersetzbarkeit und des intellektuellen Dünkels, des Kults um Ai Weiwei – sehr zu empfehlen.
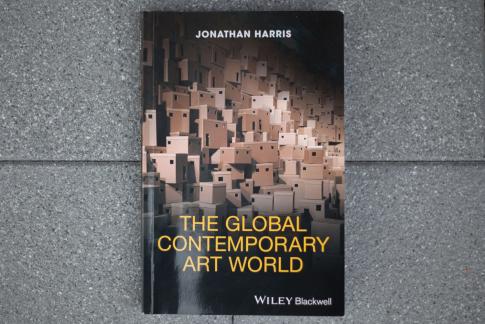
Harris, Jonathan (2017): The Global Contemporary Art World. Hoboken, NJ: Wiley.
Der Brite Jonathan Harris müsste etwa Jahrgang 1960 sein, er versteht sich als Autor, Kritiker und Historiker mit dem Fokus auf moderne und Gegenwartskunst und war an verschiedenen Universitäten tätig, zuletzt leitete er die Birmingham School of Art der Birmingham City University. Seit über dreißig Jahren ist Harris schreibend und unterrichtend, wie er sagt: „weltweit“ unterwegs. Genaue Zeitangaben macht er nicht, aber da er von 2011–15 an der Winchester School of Art der University of Southampton tätig war, muss es in diesem Zeitraum gewesen sein, dass er deren Partnerprogramm mit der Dalian Polytechnic University begleitete und in dem Zuge in China war (vgl. S. 130–32).
Sein „Global Contemporary Art World“ versteht Harris als dritten Teil „in my trilogy exploring the character, history and meaning of art made in the 20th and 21st centuries“ (S. 5), nach „Globalization and Contemporary Art“ von 2011 und „The Utopian Globalists: Artists of Worldwide Revolution, 1919–2009“ von 2013 (vgl. S. 5–7). Ähnlich ambitioniert, wie das Gesamtunterfangen klingt, ist auch diese Abhandlung. Nach einer Einleitung bespricht er in sechs Kapiteln die fünf Kunstwelten von Hongkong, Südkorea, Indien, China und Palästina. Es folgt ein Fazit als Abschlusskapitel. In dem Kapitel über China (S. 127–154) geht er auf das Bildungssystem und den, wie er es nennt, „Contemporary Chinese Art Marketed for Global Consumption“ ein. Stets ist er bemüht, die Hintergründe aufzuzeigen. Seine Vermittlung springt von einem zum anderen Großbereich und bleibt recht oberflächlich. Nicht ganz sicher bin ich mir, ob er die Verwendung chinesischer Namen einfach missversteht oder tatsächlich Ai Weiwei durch die Benennung von „Weiwei“ als seinen Buddy ansieht. Beides würde ich ihm nach der Lektüre zutrauen. Das Kapitel über Hongkong (S. 35–64) beschäftigt sich insbesondere mit dem Kunstmarkt und geht im Zuge des M+ Museums auch auf Privatmuseen vor allem in Shanghai ein (S. 48–50). Dieses Buch kann nur unter Vorbehalt empfohlen werden, ist aber als subjektive Einschätzung des Autors durchaus interessant. Sympathisch bleibt, dass Harris Utopien nachzujagen scheint.
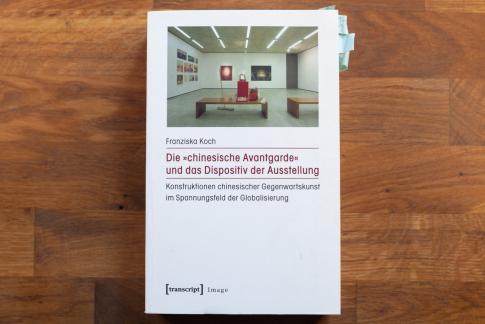
Koch, Franziska (2016): Die „chinesische Avantgarde“ und das Dispositiv der Ausstellung. Konstruktionen chinesischer Gegenwartskunst im Spannungsfeld der Globalisierung. Bielefeld: transcript.
Dieses Buch umfasst 742 Seiten, es ist größer als die Standardgröße bei Transcript und recht eng bedruckt. Es handelt sich um die kunsthistorische Dissertation von Franziska Koch, die sie 2012 im Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg abgegeben hat. Es gab eine Druckkostenförderung, aber ich bin immer wieder begeistert, was für Nischenprodukte beim Transcript Verlag zu finden sind. Die ebenfalls dort publizierte Dissertation von Meng Schmidt-Yin (2019): „Private Museen für Gegenwartskunst in China: Museumsentwicklung in der chinesischen Kultur- und Gesellschaftstransformation“ kann man sich leider getrost schenken. Doch Kochs „Dispositiv der Ausstellung“ ist eine echte Perle.
Es handelt sich um eine Untersuchung von zwanzig Großausstellung zur chinesischen Gegenwartskunst von 1982 bis 2014, die außerhalb von China im Westen stattgefunden haben. Sie stellt die jeweiligen, wie sie sie nennt, Agenten vor, ihre Institutionen und Diskurse und setzt die Ausstellungen ins Verhältnis zur innerchinesischen Entwicklung. Sie macht kleine Fehler und ihr unterlaufen marginale Ungenauigkeiten, die man bemerkt, wenn man eine Sache selbst recherchiert hat. Aber im Großen und Ganzen ist dies ein fulminant gelungenes Nachschlagewerk relevanter Ausstellungen und ihrer, wie ich sie nenne, Akteure.
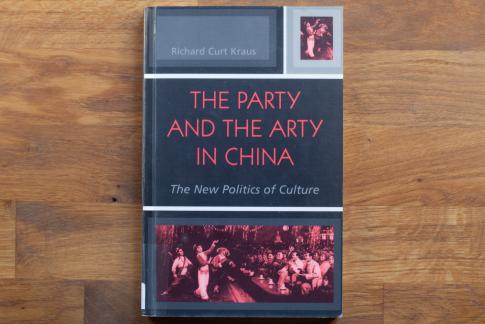
Kraus, Richard Curt (2004): The Party and the Arty in China: The New Politics of Culture. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
Seit Erscheinen dieses Bandes 2004 hat sich natürlich einiges verändert. Dieses Buch bleibt dennoch relevant für die direkte Verbindung von Kunst und Politik und für das Verhältnis zwischen Künstler:innen und der Politik. Richard Kraus ist inzwischen emeritierter Professor der Politikwissenschaften für Asienstudien der University of Oregon. Sein Fokus waren die vergleichenden Politikwissenschaften, chinesische Politik und Kulturpolitik.
Kraus beschreibt die Kulturpolitik in China in ihrem Wandel von der Zeit unter Mao als Staatskunst über die Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping hin zur Marktwirtschaft. Der Boom des Kunstmarktes hatte 2005/06 seinen ersten Höhepunkt, der mit der Weltwirtschaftskrise 2008 nicht wirklich einbrach – zwar zogen sich die Sammler aus dem Westen zurück, aber dafür betraten die chinesischen Sammler das Feld, alsbald danach auch das internationale. 2004 war Kraus diesem Phänomen bereits auf der Spur, es muss in der Luft gelegen haben, die Nullerjahre, so auch Karen Smith in „Art Unlimited?“ (s. unten Schultheis et al., S. 81), „the first decade of the 21st century was all about economics“. Kraus geht von drei Thesen aus: erstens der intellektuellen Liberalisierung durch Kommerzialisierung, die gleichzeitig Künstler:innen vor wachsende Herausforderungen stellte; zweitens dem Wandel zu einem gemischten System privater und öffentlicher Förderung – auf öffentlicher Ebene steht leider immer noch einiges aus –, wobei sein Punkt eher ist, dass Wirtschaftsreformen ernsthafte politische Reformen bedeuteten; und – mittlerweile relativiert – die westliche Anerkennung der Reformen in China, die – wobei, weiterhin vorhanden – in der Westperspektive durch eine Kombination aus „ignorance, ideological barriers, and foreign policy rivalry“ (S. vii) verschleiert betrachtet werde. Außerdem geht er Fragen der Ideologie, Propaganda und vor allem der Zensur nach. Sein ganzes Kapitel zur Nacktheit mutet etwas überholt an, ist als Hintergrund aber sinnvoll. Es bleibt ein Werk, das gut gealtert ist und in dem man weiterhin einiges nachschlagen kann.
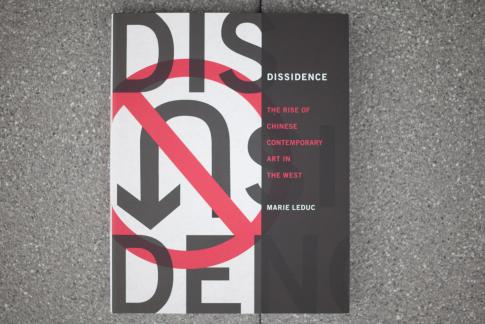
Leduc, Marie (2018): Dissidence: The Rise of Chinese Contemporary Art in the West. Cambridge, Mass.: MIT.
„Dissidence“, Opposition und Widerspruch klingen als Übersetzung eher harmlos, Dissens von Dissident:innen, es handelt sich um einen Begriff, mit dem man in Bezug auf restriktive Systeme stets Aufmerksamkeit erwecken möchte und der deshalb diesem Beigeschmack nicht entrinnen kann. Noch schlimmer ist Dissidentenkunst, aber über Ai Weiwei sind wir ja auch hierzulande nach seinem Berlinaufenthalt glücklicherweise hinweg. Nicht, dass ich gegen Konfrontation wäre, beileibe nicht. Sie findet in China nur anders statt, auch, aber nicht immer so direkt-plakativ, dass man sie im Westen sofort versteht, traditionell sowieso eher zwischen den Zeilen. Marie Leduc spricht dieses Thema nicht so platt abwertend wie ich an, aber auch ihr geht es um die Sehnsucht des Westens nach politischer Provokation, die nach dem Tian‘anmen Massaker 1989 begann und sich daraufhin verstärkte. Dafür steht der Verweis des Emblems auf dem Cover, das von der „China/Avant-Garde“-Ausstellung 1989 in Beijing stammt, im Februar, als man sich noch frei wähnte und die Avantgarde war. Ab Juni 1989 wurde der Westen aufmerksam, in China selbst zog man sich vermehrt zurück. Zunächst fragt Leduc nach dem Wert des Dissens in der Kunst und stellt Künstler:innen vor, die als Dissident:innen bekannt wurden. Sie untersucht die Ausstellung „Magiciens de la Terre“ von 1989 im Centre Pompidou, einer frühen Ausstellung gegen die eurozentrische Perspektive mit Arbeiten von hundert zeitgenössischen Künstler:innen aus aller Welt – nagut, immer noch eher Künstlern, aus China waren Huang Yongping, Gu Dexin und Yang Jiechang dabei. Mit dem Vermächtnis auch dieser drei als der Avantgarde hinterfragt sie weitere Themen wie Kunst und Revolution (als Dissens), freie Meinungsäußerung und Gegenwartskunst im Zuge der Globalisierung. Ich bin des Themas ein wenig müde, es bleibt leider weiterhin notwendig, dafür gibt es zu wenige – jetzt möchte ich Direktheit – Primärstimmen aus China.
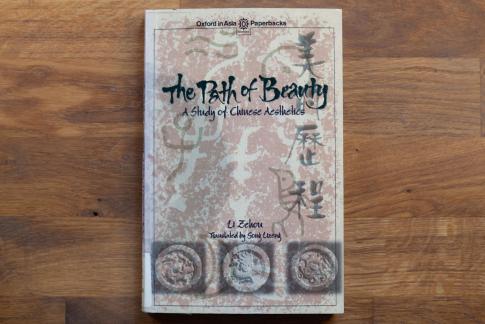
Li Zehou 李泽厚 (1994 [1981]): The Path of Beauty: A Study of Chinese Aesthetics (Original: 美的历程). Übersetzung: Gong Lizeng. Hongkong und New York: Oxford UP.
Li Zehou (1992): Der Weg des Schönen: Wesen und Geschichte der chinesischen Kultur und Ästhetik. Übersetzung: Karl-Heinz Pohl und Gudrun Wacker. Freiburg im Breisgau u. a.: Herder.
Es gibt wirklich hässliche Coverdesigns. Li Zehou trifft keine Schuld, alle chinesischen Versionen sind um Meilen angenehmer, so auch die deutsche Ausgabe von 1992 und das englische Hardcover von 1989. Nur noch antiquarisch und einigermaßen erschwinglich blieb mir dieses ehemalige Bibliotheksexemplar. Kann das irgendjemand ernst meinen, selbst Mitte der 1990er Jahre, selbst als akademische Publikation, vor allem aber bei einem Buch über Ästhetik? Wenigstens existiert kein Hinweis auf das Grafikbüro. Es handelt sich um ein Standardwerk, das nicht wegen des Covers, sondern seines Inhalts gekauft werden sollte. Man muss sich nur überwinden, es aufzuklappen, dann verschwindet die hellbraune Verstörung von selbst.
Wie oben Chengs „Fülle und Leere“ und unten Zhus „Philosophie“ habe ich Lis „Path“ als Hintergrund hier aufgenommen, der dabei hilft, durch die Tradition die Gegenwart einzuordnen. Es existieren etliche wunderbare Abhandlungen zur traditionellen chinesischen Malerei, allgemeine Sammelbände über Kunst in China, häufig in gewaltigen Schritten durch die einzelnen Kaiserreiche schreitend. Diese drei exemplarischen Werke ermöglichen einen Einblick in die Gedankenwelt des alten China und dessen künstlerische Herangehensweisen, die chinesischen Künstler:innen auch heute noch präsent sind.
Chronologisch aufgebaut, beginnt diese Abhandlung mit dem mythologischen Zeitalter der „Drachen und Phönixe“, der Bronzezeit und Prä-Qin bis zur Einigung des Landes unter dem ersten Kaiser. Stets kunsthistorisch, also mit historischen Hintergründen und sozialen Veränderungen, begibt Li sich dann in die Zeit, die er die „Romantik der Chu und Han“ nennt. Durch die Epochen wandernd, sortiert er unterschiedliche Stilrichtungen, bespricht buddhistische Einflüsse, die Hochphase der Tang, die Vorstellung von Rhythmus und wie damit umgegangen, darüber hinausgegangen wird, wie es zur wichtigen Phase der Landschaftsmalerei der Song kam. Kunst und Literatur als Künste zusammen betrachtend, schließt Li mit den Haupttrends in der Ming- und Qing-Dynastie, er endet mit dem Ende des Kaiserreiches mit den Einflüssen der Umgangssprache und reflektiert über die Kunst als Handwerk. Die nur gut 230 Seiten liefern eine empfehlenswerte Grundlage zum Verständnis von Kontext und Entwicklung der Künste.
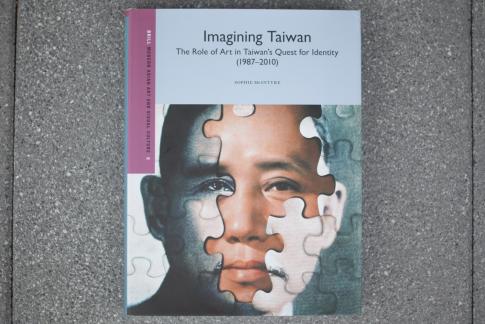
McIntyre, Sophie (2018): Imagining Taiwan. The Role of Art in Taiwan‘s Quest for Identity (1987–2010). Leiden und Boston: Brill.
Selbst war ich noch nie auf Taiwan und habe keine Ahnung von dem Land. Eine Übersetzung für das Palastmuseum in Taipei war bislang mein einziger direkter Kontakt mit der abtrünnigen Insel aus meiner Festlandsperspektive. Letztens meinte eine Freundin, sie würde gerne hin, wenn das Reisen denn wieder möglich wird, solange Taiwan, so ergänzte sie quasi prä-nostalgisch, noch Taiwan sei. Die Australierin Sophie McIntyre kennt Taiwan. Sie ist Kuratorin und Dozentin an der Queensland University of Technology. „Imagining Taiwan“ basiert auf ihrer Dissertation, die sie, eine Jahresangabe ist nicht zu finden, an der Australian National University eingereicht hat. Die vorliegende Abhandlung habe sich über zwanzig Jahren hinweg entwickelt. Es geht um die Kunst taiwanesischer Künstler:innen, um Museumspolitik, Identität und Anerkennung, anhand von Fallstudien um die Dekonstruktion, die Erzählbarkeit, um die Identitätsbildung und Entmythologisierung des Begriffs und Verständnisses von Nation. Weiter geht es um den Aufstieg Chinas und die Notwendigkeit der Neuorientierung Taiwans, hier werden etwa die Biennalen in Taipei und Venedig gegenübergestellt. Das Buch hat beinahe das Format eines Ausstellungskataloges, es ist reich bebildert und man merkt ihm die Kuratorin an.
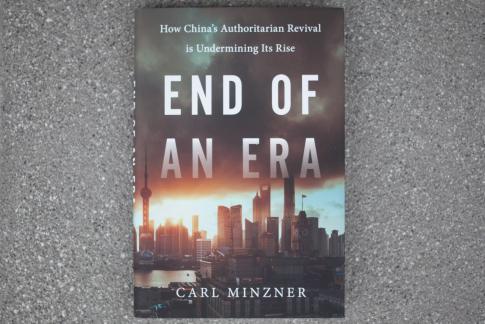
Minzner, Carl (2018): End of an Era: How China‘s Authoritarian Revival is Undermining Its Rise. New York: Oxford UP.
Auch dieses Werk bietet einen Hintergrund, in diesem Fall einen politisch-gesellschaftlichen. Mit dem titelgebenden Ende einer Ära ist die unter Deng Xiaoping begonnene Reformära gemeint, und da jedem Ende ein Anfang innewohnt, bezieht sich dieser gleichzeitig auf den Beginn der Neuen Ära von Xi Jinping. Der amerikanische Juraprofessor Carl Minzner ist auf chinesisches Recht und Governance in China spezialisiert und charakterisiert hier die Kernfaktoren im Wandel von Ende und Anfang. Diese beinhalten politische Stabilität, ideologische Öffnung und rasantes Wirtschaftswachstum. An der Oberfläche erscheine es, dass Chinas Führung sich einer tiefgreifenden Reform seit den 1990ern verweigert habe. Während um das Land und weltweit Aufruhr herrsche, erscheine China als stabil und in stetigem Aufschwung. Doch seit den letzten dreißig Jahren habe ein erstarrtes politisches System die fest verwurzelten Interessen innerhalb der KPCh und die systematisch unterentwickelten Regierungsinstitutionen angetrieben. Wirtschaftliche Spaltungen haben sich genauso vermehrt wie soziale Unruhen und ideologische Polarisierung. Der Umgang damit sei ein progressives Ausschlachten institutioneller Normen und Praktiken von Seiten der Führungsebene. Die technokratische Führung weiche dem, was Minzner Blackbox-Säuberungen nennt, und das kollektive Regieren falle zurück auf eine Ein-Personen-Herrschaft. Die Reformära der Öffnungen sei beendet, China mache dicht. Minzner betrachtet dies unter den Aspekten Gesellschaft und Wirtschaft, Politik, Religion und Ideologie sowie in vergleichender Perspektive insbesondere zu Taiwan und Südkorea. China stehe an einem gefährlichen Wendepunkt. Am Ende seines Buches spielt Minzner mögliche Zukunftsszenarien durch, den Untergang des liberalen Traums, die Weiterführung autoritärer Führung, die Verstärkung des Nationalpopulismus, eine Wiederbelebung des dynastischen Zirkels, einen Zusammenbruch des Regimes und verschiedene Möglichkeiten weltweiten Umgangs damit.
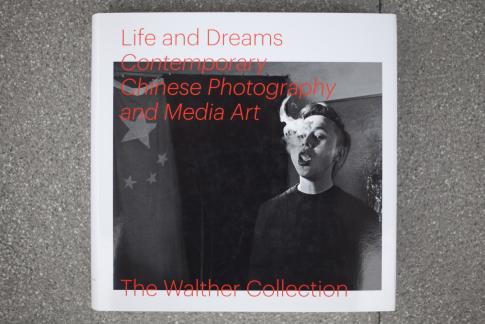
Phillips, Christopher und Wu Hung (Hgg.) (2018): Life and Dreams: Contemporary Chinese Photography and Media Art. New York und Göttingen: The Walther Collection und Steidl.
Vor mir liegt ein sehr schöner, dicker Bildband mit einer Zusammenstellung von knapp fünfzig Fotograf:innen. Es handelt sich insbesondere um bekannte Namen wie Cang Xin, Cao Fei, Hong Hao, Rong Rong, Song Dong, Sun Xun, Wang Gongxin, Yang Fudong, Zhang Dali, Zhang Peili, Zhou Tiehai, Zhuang Hui und vielen mehr. Jede/r Fotograf:in erhält meist drei, mal eins, mal fünf Bilder Platz, die Titel finden sich gesondert am Ende, wodurch keine Ablenkung von den Bildern entsteht. Wie es sich gehört, finden sich ebenfalls am Ende die Biografien der vorgestellten Künstler:innen. Ergänzt wird dieser Band mit einer Reihe von Essays, etwa von Wu Hung mit seinem Ruinenansatz, Rong Rong zur Avantgarde-Fotografie, Karen Smith über Aufklärung durch die Linse, Lu Yang zu neuen Medien und anderen. Es sind keine neuen Positionen zu erwarten, aber ein guter Überblick des Bekannten.
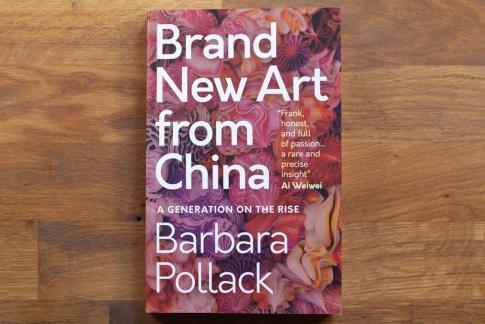
Pollack, Barbara (2018): Brand New Art from China: A Generation on the Rise. London und New York: I.B. Tauris.
Barbara Pollack, Journalistin (New York Times, ARTnews), Kunstkritikerin und Kuratorin (in China etwa im Yuz Museum und im Long Museum), schreibt neben anderen Themen seit gut fünfzehn Jahren über die Kunstszene in China. So verfasst sie seit Mitte der 2000er Artikel über Ai Weiwei – weshalb vermutlich ein Zitat von ihm ihr „Brand New Art“-Cover ziert. Davon sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen. Mit teils etwas rudimentären, aber anschaulichen Einschätzungen zur kulturellen, politischen und gelegentlich historischen Lage, vor allem aber mit vielen Beispielen von Künstler:innen ab der 1980-Generation basiert Pollacks Buch auf Gesprächen mit den Akteur:innen der Szene. Die thematische Unterteilung ist grob chronologisch und beschäftigt sich etwa mit Chineseness, Abstraktion, Post-Truth und Post-Internet Kunst und endet in New York. Ai kommt auch vor, der Fokus richtet sich aber auf die Generation von Cao Fei und jünger. Pollacks Darstellung bietet eine kurzweilige Momentaufnahme insbesondere der Metropolkunst in China der 2010er Jahre.
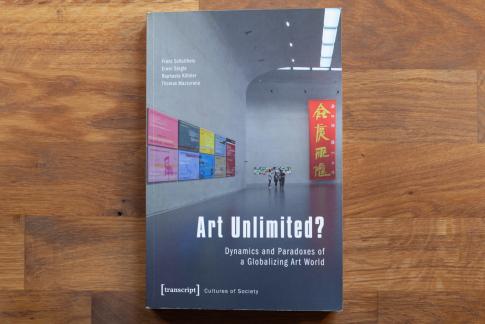
Schultheis, Franz, Erwin Single, Raphaela Köfeler und Thomas Mazzurana (2016): Art Unlimited? Dynamics and Paradoxes of a Globalizing Art World. Bielefeld: transcript.
Man ist doch immer wieder überrascht, wie viele Leute ohne jegliches Vorwissen in ein fremdes Land gehen, sich dort ein paar Monate oder ein Jahr aufhalten und dann ein Buch darüber schreiben. Häufig erschauern einen die getroffenen Aussagen, genauso häufig ist man erstaunt, wie viele der relevanten Kontakte ausfindig gemacht wurden. Vermutlich ist die Szene wirklich so klein, die leichte oder schwierige Zugänglichkeit mag eine Charakterfrage sein – oder berufsbedingt.
Die Autoren dieses Bandes sind alle Soziologen, die sich offensichtlich erstmals mit China beschäftigen. Es handelt sich um eine Sammlung von Interviews mit Kurator:innen, Galerist:innen, Sammler:innen und ähnlichen Akteuren, die 2013/14 im Zuge eines Studienprojektes der Universität St. Gallen geführt wurden. Es ist ganz lustig, wie immer wieder ähnliche Fragen gestellt werden. Offensichtlich sind die Autor:innen die gesamte Zeit dabei, das Phänomen zu verkraften, dass chinesische Sammler:innen, zumindest wenn sie gerade mit dem Sammeln beginnen, sich zunächst über die Auktionshäuser – und nicht wie im Westen primär über Galerien – dem Markt nähern. Auch sonst drehen sich viele Fragen um das Marktverständnis. Die Autor:innen scheinen ihren Hauptzugang über die Art Basel in Hongkong erhalten zu haben und von dort losgezogen zu sein. Lesenswert sind besonders die Interviews mit Karen Smith (damals Beijing, heute Xi‘an, vermutlich bald Shanghai), Robin Peckham (damals Hongkong), Colin Chinnery (Beijing) und Tobias Berger (damals Hongkong). Vor allem Meg Maggio (Beijing) und Gu Ling (damals Shanghai) setzen einiges an Westlerperspektive der Autor:innen zurecht, was sich ganz amüsant liest.
Um die bei Kraus oben bereits zitierte Stelle von Karen Smith aufzugreifen, hier ihre sehr schön prägnante Einordnung der jeweiligen Dekaden (S. 81): „The 80s was pervaded by a kind of freedom; the 1990s was very political. Suddenly, the first decade of the 21st century was all about economics. This second decade feels rather flat. Perhaps it is needed as a period to reflect and put everything in perspective. Out of that, some new, stronger contemporary cultural identity will emerge for the 2020s, which will be tied to what will happen in China as China‘s position in geopolitics becomes ever more clearly defined.“
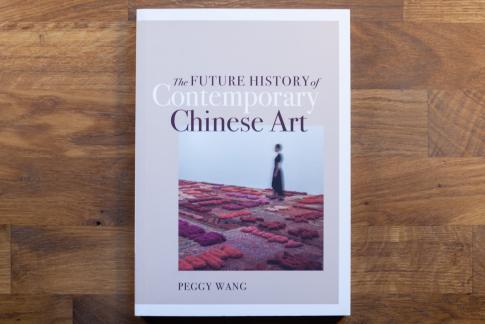
Wang, Peggy (2020): The Future History of Contemporary Chinese Art. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Der Ansatz von Peggy Wang ist ganz interessant. Hier geht es um die international renommierten Künstler:innen der 1950er/1960er-Generation Zhang Xiaogang, Wang Guangyi, Sui Jianguo, Zhang Peili und Lin Tianmiao. Auch hier geht es (wie oben bei Leduc) zunächst, da auf Englisch und entsprechend hauptsächlich für ein westliches Publikum geschrieben, nicht um, sondern gegen die westliche Suche nach Sozial- und Politikkritik bei Dissidenten. Diese ist in den besprochenen Kunstwerken auch vorhanden, aber natürlich steckt viel mehr dahinter. Als „Zukunftsgeschichte“ bezeichnet Wang ihre Neuinterpretationen in Form, Bedeutung und Möglichkeiten der Werke für sich und in Bezug auf die Kunstgeschichte in China und global. Sie legt die häufigen Fehllesungen dar, auch der Künstler:innen selbst, etwa in Bezug auf den Westen. Außerdem geht es gelegentlich um die Einflüsse, die diese fünf Künstler:innen auf andere genommen haben.
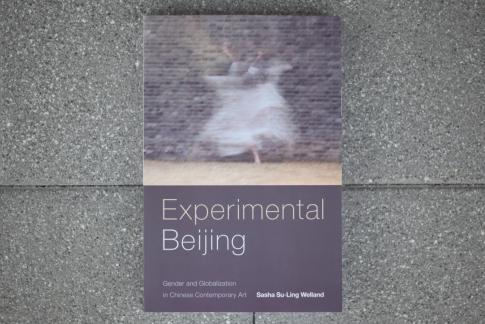
Welland, Sasha Su-Ling (2018): Experimental Beijing: Gender and Globalization in Chinese Contemporary Art. Durham und London: Duke UP.
Als ethnografische Feldarbeit beschreibt Sasha Welland ihre Untersuchung, die sie unter der Prämisse der Kommerzialisierung besonders von experimenteller Kunst vorgenommen und seit und auf die Olympischen Spiele 2008 zugehend wahrgenommen hat. Entsprechend lässt sie Stimmen von Künstler:innen, Kurator:innen, von offizieller Seite und von Stadtplaner:innen zu Wort kommen. Diese tarieren die soziale Rolle von Kunst aus und beschäftigen sich mit dem Aufbau neuer Kulturinstitutionen. Welland vertritt die These, dass Genderthemen ein verändertes Bewusstsein der Kunstgeschichte in China herbeiführen würden, die Globalisierung scheint als Dialog gemeint. Klar, für China nicht aber doch recht gewagt? Da mir genderspezifische Themen in China bislang nur eher am Rande untergekommen waren, lese ich natürlich gerne mehr davon. Vor allem ihre Einordnung von Begriffen und besonderen Pop-up-Phänomenen finde ich ganz interessant.
Zu dieser Druckversion hat Welland ein kleines digitales Kompendium geschaffen.
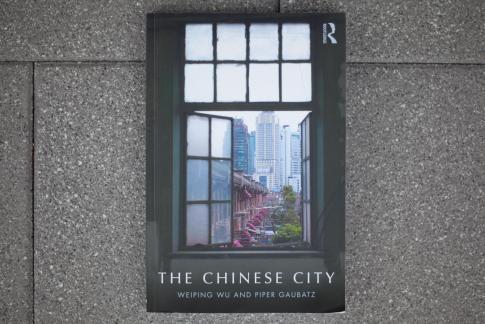
Wu, Weiping und Piper Rae Gaubatz (2013): The Chinese City. London und New York: Routledge.
Hier geht es nicht um Kunst, sondern um Stadtentwicklung in China – einem äußerst wichtigen, da lebensessentiellen Thema der chinesischen Gegenwart und damit in der Gegenwartskunst und deshalb eine passende Ergänzung in dieser Liste. Obwohl diese Abhandlung bereits ein wenig älter ist und etwa die Abrisswucht unter Xi Jinping insbesondere von 2017 in Beijing noch nicht miterleben musste (s. als Beispiele aus Beijing hier, hier oder hier), bietet sie reichlich Material zum strukturellen Verständnis chinesischer Städteplanung. Wu und Gaubatz liefern fundierte Hintergründe, nicht nur, aber auch an historischem Kontext und geografischer Kulisse. Mit zahlreichen Statistiken, meist von 1949 bis 2009, beleuchten sie das Urbanisierungsphänomen, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation, der Infrastruktur sowie der Land- und Hausreformen und -bedingungen. Sie hinterfragen den urbanen Lebensstandard unter zivilgesellschaftlichen Gesichtspunkten und die urbane Governance. Ich habe bereits die eher architektonische Sicht von Dieter Hassenpflug (2009): „Der urbane Code Chinas“, Basel und Berlin: Birkhäuser, mit Gewinn gelesen, es gibt auf diesem Gebiet natürlich zahlreiche Essays und für mich handelt es sich eher um ein Hobbythema, dennoch finde ich, dass Wu und Gaubatz hier ein bemerkenswertes Fundament bieten.
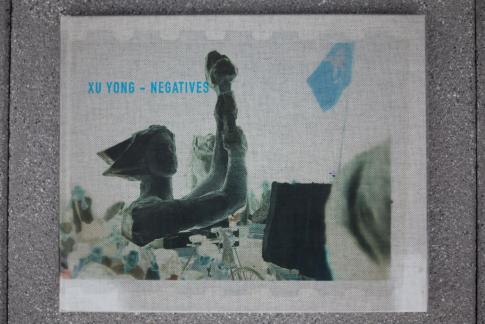
Xu Yong 徐勇 (2015): Negatives. Dortmund: Kettler.
Gerade jährte sich das Tian‘anmen Massaker am 4.6.2021 zum 32. Mal. Zum ersten Mal gab es dieses Jahr kein offenkundig öffentliches Mahnmal in Hongkong. Der Fotograf Xu Yong hatte 1989 etliche Filmrollen auf dem Platz des Himmlischen Friedens belichtet. Er ließ sie über zwanzig Jahre in den Tiefen seiner Schubladen ruhen. Auch für diese Publikation im Ausland von 2015 wählte er nicht den direkten Weg der Positiventwicklung, das Thema war und ist einfach noch viel zu heikel. Mit einer einfachen Einstellung lassen sich die Bilder auf dem Handy im Positiv betrachten, tatsächlich changieren aber die negative Fotoästhetik und der dadurch gewonnene Abstand auf ihrer ganz eigenen Skala von Schönheit und Grauen.
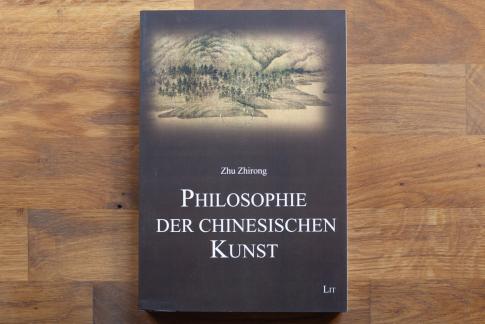
Zhu Zhirong 朱志荣 (2020 [2012, 1997]): Philosophie der chinesischen Kunst (Original: 中国艺术哲学). Übersetzung: Eva Lüdi Kong. Berlin: LIT.
Wie oben bereits geschrieben, habe ich diese Abhandlung genauso wie Chengs „Fülle und Leere“ und Lis „Path of Beauty“ mit aufgenommen, weil sich Gegenwarten durch Blicke auf Vergangenheiten und ihre Traditionen erhellen.
Man könnte sagen, dass es sich um die Neuauflage von Lis „Path of Beauty“ handelt. Hier erfolgt allerdings anstelle der chronologischen eine thematische Unterteilung. Diese ist sehr detailliert, was den großen Reiz des Buches ausmacht. Allein durch das ausschweifende Inhaltsverzeichnis erhält man einen guten Einblick in das Themenfeld der chinesischen Ästhetik und Gedankenwelt.
Die Einordnungen „zur energetischen Wirkung und geistigen Ausstrahlung“ seien von daoistischen und konfuzianischen Weltanschauungen durchdrungen, weshalb diese Abhandlung mit „Philosophie der chinesischen Kunst“ betitelt sei (S. i). Die Kunsttheorie des alten China wird mit ihren eigenen Kategorien dargestellt. Die fünf Kapitel („Das künstlerische Selbst“, „Kunst an sich“, „Besondere Eigenschaften“, „Geistiger Ausdruck“ und „Entwicklungsgeschichte“) sind in angenehme kleine Häppchen unterteilt. Nach der Herangehensweise, den schöpferischen Quellen, dem Umgang mit Ruhe, Erkennen und Vitalität, werden Bedeutung, Form, Struktur, Rhythmus, Bildgestalt, Resonanz und vieles mehr behandelt. Zhu geht auf das Verständnis von Zeit und Raum, Innen- und Außenwelt, Subjekt und Objekt ein, und es folgen immer wieder Abschnitte zu den grundlegenden Eigenschaften. Die zahlreichen Zitate der Dichter und Denker werden stets in Kontext gesetzt und bilden mit der poetischen Denkweise der Dichtkunst die Basis zu den Erklärungen und Einordnungen. Die Begriffe, Personen und Werke sind durchweg auch auf Chinesisch wiedergegeben, Eva Lüdi Kong lebe hoch. Leider muss dieses Buch ganz ohne Abbildungen auskommen.
Romane aus und über China
Ich behaupte immer, nie Krimis zu lesen, und auch Scifis machen bei mir normalerweise keine 4/5-Romanration aus. Hier gibt es von mir einen Krimi und vier Sciencefiction-Romane, alle fünf taugen genauso wunderbar als Lockdown- wie als sommerliche Urlaubslektüre.
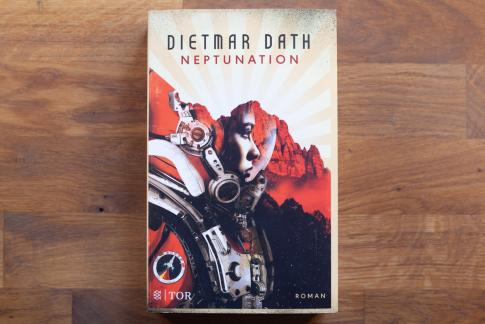
Dath, Dietmar (2019): Neptunation. Frankfurt a. M.: Fischer Tor.
In diesem Scifi bricht ein deutsch-chinesisches Rettungsteam dreißig Jahre nach Ende des Kalten Krieges auf, um dem Signal einer damals von der Sowjetunion und der DDR entsendeten Mission nachzugehen.
Neben der marxistischen Grundeinstellung hat mich besonders gefreut, dass der Beijinger Künstler Wang Guangle hier einen kurzen Auftritt hat, S. 290f. Es geht bei der „schwebende[n], konvex elliptische[n] Form aus weißer Farbe“ um Wangs Arbeit, die er 2011 in der Beijing Commune im 798 ausgestellt hat (s. hier). Einerseits soll die Arbeit nicht interpretiert werden, „also bitte keine Kunstvorträge jetzt von Cordula, dass das irgendwie das Unbewusste der Macht oder die Dialektik der Arbeitsteilung oder so was darstellt“, andererseits erinnere diese Arbeit „uns nicht an das, was wir sind, sondern lässt uns vergessen, wo wir sind: im Weltraum, wo es nicht nur keine Kunst gibt, sondern nicht mal was zu essen“. Den einen oder anderen Dath kann man sich unbedingt gelegentlich gönnen.
Passenderweise lief kürzlich ebenda wieder eine Soloshow von Wang: „Wang Guangle 王光乐: Waves 波浪“, in: Beijing Commune 北京公社, 15.4.–28.5.2021.
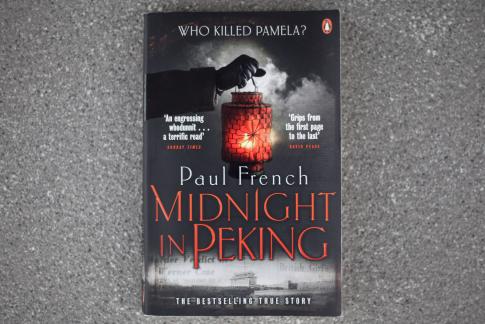
French, Paul (2012 [2011]): Midnight in Peking. The Murder That Haunted the Last Days of Old China. London: Penguin.
Der Brite Paul French lebte um 2010 zehn Jahre in Shanghai, spricht Chinesisch (das muss leider immer noch gesagt werden) und schreibt als Journalist und Schriftsteller über Gesellschaft und Geschichte in China, mit Fokus auf das Ende des Kaiserreichs und die Republikzeit. „Midnight in Peking“ ist eine Dokufiktion über den unaufgeklärten Mord an der jungen Britin Pamela Werner im Jahr 1937 im Gesandschaftsviertel von Beijing. Es geht um das Leben der damaligen Expats, um Gesandte, Händler und andere Lebenskünstler, in Konfrontation mit der chinesischen Polizei zu Beginn der japanischen Invasion vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Mit, so Frenchs Erzähler, bislang unbekannten Dokumenten wird der Mord gar aufgedeckt ? Wie auch in seinen anderen Büchern, scheint French den Duktus der damaligen Zeit glaubwürdig zu beherrschen. Es ist ein Genuss, ihm durch die Hutongs und die Stadtmauern entlang zu folgen.
Berichten zufolge (Forbes 2012, 澎湃 2019) wird gelegentlich über eine Verfilmung von „Midnight in Peking“ spekuliert – ich würde mich sehr darüber freuen.
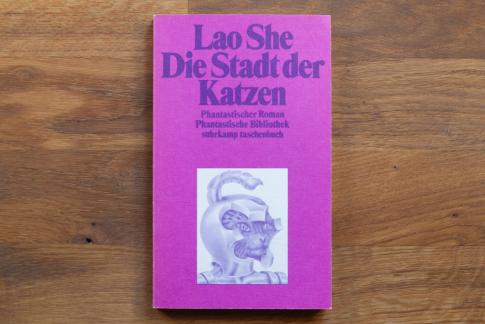
Lao She 老舍 (1985 [1933]): Die Stadt der Katzen (Original: 猫城记). Übersetzung: Volker Klöpsch. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Wer noch nichts von Lao She gelesen hat, dem sei besonders dieser Scifi empfohlen – oder auch Gesellschaftsroman, darüber streiten sich die Geister. Zumindest spielt er auf einem fernen Planeten mit Katzen als Bewohnern. Das Gesellschaftsbild ist so wunderbar auf Lao Shes Zeit übertragbar wie auf die heutige, aber das soll bei Scifis ja gelegentlich auch der Fall sein.

Liu, Cixin 刘慈欣 (2017 [2006]): Die drei Sonnen (Original: 三体). Übersetzung: Martina Hasse. München: Heyne.
Teil 1 der Trilogie.
Teil 2: Der dunkle Wald (2018 [Original: 黑暗森林, 2008]), Übersetzung: Karin Betz.
Teil 3: Jenseits der Zeit (2019 [Original: 死神永生, 2010]), Übersetzung: Karin Betz.
Liu Cixins Trilogie braucht kaum noch eine Vorstellung, so allgemein bekannt ist dieser Scifi. Der dritte Teil erschien mit einer leider immer holpriger werdenden Übersetzung auf Deutsch bereits vor Corona, ich habe ihn damals natürlich sofort gelesen. Der erste Teil bleibt der stärkste und, wenn man Cliffhängern widerstehen kann, besonders lesenswert. Andererseits sollte dazu unbedingt der zweite Teil gelesen werden, denn wer möchte schon die Theorie des dunklen Waldes in seinem Leben missen? Wer auf sich aufmerksam macht, wird angegriffen, bevor er/sie angreifen kann – gibt es in Lius Version natürlich um Seiten länger und Bildlängen grandioser.
Als Einschätzung aus sehr deutscher Perspektive sei die Podcastfolge von Kapitel Eins: Die drei Sonnen von 2018 empfohlen.
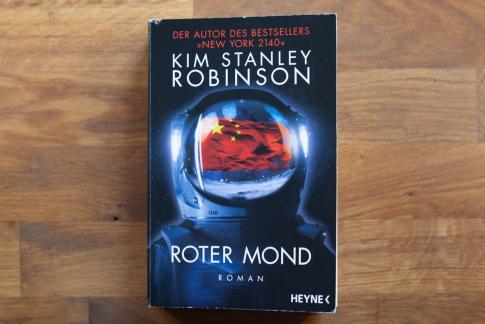
Robinson, Kim Stanley (2019 [2018]): Roter Mond (Original: Red Moon). München: Heyne.
Leider sollten Scifis (zumindest die von Heyne publizierten?) wohl im Original gelesen werden, kein Wunder, dass das Genre nicht als Hochliteratur bekannt ist. Aber wenn man sich durch den gruseligen Anfang gebissen hat, weil man wieder zu faul war, sich technischen Erklärungen auf Englisch, geschweige denn auf Chinesisch zu stellen, dann hat man sich an die Schreibe gewöhnt und kann über Hunderte von Seiten in fremde Welten abtauchen.
2048 hat China hier die Vorherrschaft in der Kolonisierung des Mondes übernommen, weshalb er der Rote Mond genannt wird. Vielleicht haben Xi Jinpings Taikonauten Robinson gelesen, bevor sie Anfang 2019 auf der Schattenseite unseres Trabanten landeten – dieser Plan war wahrscheinlich bereits vorher gereift, aber auch verkündet? Und was haben sie dort wirklich angestellt? Bei Robinson befindet sich auf der Schattenseite des Mondes etwa ein unterirdisches, einem traditionellen chinesischen Landschaftsgemälde nachempfundenes Gelände. Die Chinesen wissen hier einfach nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ein Mord auf dem Mond verbindet einen alten chinesischen Dichter, der inzwischen nur noch Videoblogs publiziert, eine chinesische Kadertochter und einen amerikanischen Techy miteinander. Natürlich geht es auch hier letztendlich um die Rettung der Welt.
„Inzwischen waren die Generationen, die bis zur ersten um Mao zurückreichten und zu der Zhou Enlai, Deng Xiaoping und die anderen Acht Unsterblichen gehört hatten, eher eine nominelle Angelegenheit. Die Folgegenerationen wurden lediglich anhand der jeweiligen Generalsekretäre, der Parteikongresse und des gesetzlichen Rücktrittsalters durchnummeriert. Unterm Strich kam dabei heraus, dass heutzutage alle zehn bis zwanzig Jahre eine neue Führungsgeneration antrat. Im Prinzip handelte es sich um einen ziemlich konstruierten Begriff, aber trotzdem wurde er oft verwendet und kombinierte die chinesische Vorliebe für nummerierte Listen mit einem allgemeineren menschlichen Bedürfnis nach einer Periodisierung der Geschichte, in dem hoffnungslosen Versuch, den menschlichen Geschicken einen Sinn abzuringen, indem man eine Art Feng Shui mit der Zeit betrieb.“ (S. 182f.)
Im Prinzip erwarte ich eher, dass Xi bis 2048 durchregiert, dann wäre er 95 Jahre alt, das halte ich nicht für abwegig. Und ist eine generative Nummerierung spezifisch chinesisch? Andrew Batson ist in „How plausible is the China in Kim Stanley Robinson‘s *Red Moon*?“, 2.3.2019, nicht überzeugt von Robinsons China-Vision, die er mehr als heutige Version mit etlichen Fehlern liest. Ich mochte das Buch trotzdem und fand es gerade wegen der Zustandsbeschreibungen von China aus amerikanischer Sicht interessant.
--
Aktuell werde ich gut unterhalten von Dana Spiottas (2008 [2006]): „Eat the Document“, Köln: KiWi; ohne China-Bezug.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Bücher 书籍, Bildende Kunst 美术, Literatur 文学

Diese Liste ist natürlich längst nicht als erschöpfend, sondern als (relativ oder immer noch) aktuelle Auswahl zu begreifen.
Sachbücher: Kunst in China
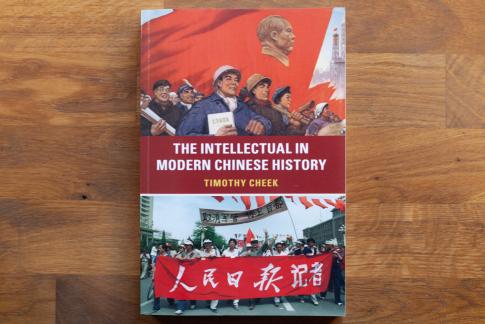
Cheek, Timothy (2015): The Intellectual in Modern Chinese History. Cambridge: Cambridge UP.
Dem Alphabet folgend, beginnt diese Liste mit einem der Randbereiche für die Gegenwartskunst in China, mit den chronologisch beschriebenen Diskursen der Intellektuellen von 1895 bis 2015, von der Niederlage im Sino-japanischen Krieg bis zum Aufschwung im Zuge der Olympischen Spiele 2008 und ihren Nachklängen. Cheeks Inhaltsverzeichnis ist sehr aussagekräftig, weshalb ich es hier wiedergebe. In Zwanzigjahresschritten sind stets ein Umbruch und ein Motto genannt, die sich auf die politische Situation beziehen. Cheek beginnt mit China in den 1910er Jahren: „Reform: making China fit the world“, die 1930er nennt er: „Revolution: awakening New China“, die 1950er: „Rejuvenation: organizing China“, die 1970er: „Revolutionary revival: overthrowing the lords of nation-building“, die 1990er: „Reviving reform: correcting revolutionary errors“ und endet mit den 2010er Jahren: „Rejuvenation: securing the Chinese Dream“. Die Darstellung folgt den wichtigsten Protagonisten, ihren Ideen und Begrifflichkeiten sowie ihren Ansätzen und Aktionen auf Grundlage der politischen Lage.
Für den Anschluss an diese Abhandlung möchte ich gerne auf Minzners unten empfohlenes Werk „End of an Era“ verweisen.
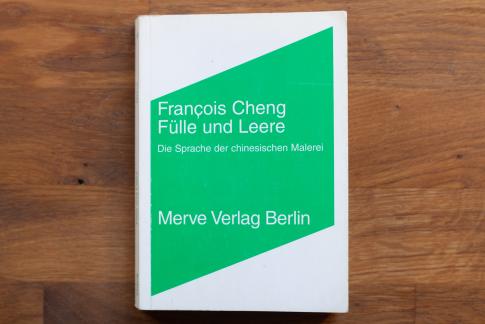
Cheng, François (2004 [1991]): Fülle und Leere. Die Sprache der chinesischen Malerei (Original: Vide et plein. Le langage pictural chinois). Berlin: Merve.
Chengs „Fülle und Leere“ ist hier, genauso wie Lis „Path of Beauty“ und Zhus „Philosophie der chinesischen Kunst“, als Ergänzung zum Verständnis der Gegenwartskunst aufgenommen.
Bei Cheng geht es um den bis heute wichtigen traditionellen Begriff der Leere im Verhältnis von Mensch und Universum als Theorie in der chinesischen Philosophie und als praktische Anwendung in der Malerei. Nach einer Einführung von der Tang- bis zur Qing-Dynastie werden das grundlegende Konzept der Leere und die grundlegenden Begriffe der traditionellen chinesischen Malerei vorgestellt. Mit anschaulichen Bildbeispielen werden die verschiedenen Pinselführungen genauso beschrieben wie Form und Volumen, Verhältnis und Proportion und die drei Perspektiven der Malerei. Es folgt eine Zusammenfassung der Fachbegriffe der verschiedenen Ebenen: „Pinsel-Tusche“, „Dunkel-Hell“, „Berg-Wasser“, „Mensch-Himmel“ und „Die fünfte Dimension“, also die Leerheit (S. 126–132). Das letzte Viertel des kleinformatigen, 180 Seiten umfassenden Buches ist beispielhaft der Malerei von Shi Tao 石涛 (ca. 1641– ca. 1707) aus Wuzhou, Guangxi gewidmet.
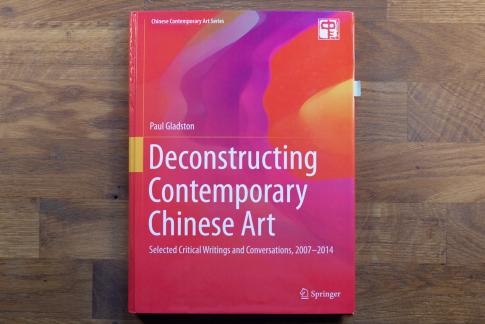
Gladston, Paul (2016): Deconstructing Contemporary Chinese Art: Selected Critical Writings and Conversations, 2007–2014. Berlin und Heidelberg: Springer.
Ganz witzig finde ich, dass diese Ausgabe das Format meines alten Diercke Weltatlas hat, leider fällt dieses Buch im Gegensatz zum Diercke schnell auseinander. Es handelt sich um eine Ausgabe der „Chinese Contemporary Art Series“, von 2015 bis heute, der China Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing, in der der Australier Paul Gladston die stellvertretende Chefredaktion innehat. Nach Gladstons „Contemporary Chinese Art: A Critical History“, London: Reaktion Books 2014, sowie etlichen anderen Büchern und Artikeln aus seiner Feder, handelt es sich hier um eine Zusammenstellung verschiedener seiner Schriften, Gespräche und Ausstellungsbeschreibungen zwischen 2007 und 2014 und basiert insbesondere auf seinem Aufenthalt in China 2005–2010. Dargestellt wird die chinesische und internationale Entwicklung der Gegenwartskunst in China. Dies geschieht etwa unter Aspekten der Modernität und Tradition, der kuratorischen Praxis und der internationalen Problematik der Deterritorialisierung von Identitätsausstellungen, der Avantgardekunst, der kulturellen Übersetzbarkeit und des intellektuellen Dünkels, des Kults um Ai Weiwei – sehr zu empfehlen.
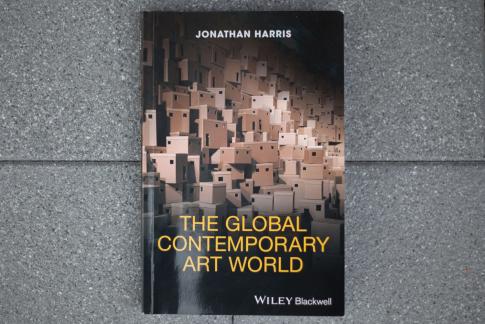
Harris, Jonathan (2017): The Global Contemporary Art World. Hoboken, NJ: Wiley.
Der Brite Jonathan Harris müsste etwa Jahrgang 1960 sein, er versteht sich als Autor, Kritiker und Historiker mit dem Fokus auf moderne und Gegenwartskunst und war an verschiedenen Universitäten tätig, zuletzt leitete er die Birmingham School of Art der Birmingham City University. Seit über dreißig Jahren ist Harris schreibend und unterrichtend, wie er sagt: „weltweit“ unterwegs. Genaue Zeitangaben macht er nicht, aber da er von 2011–15 an der Winchester School of Art der University of Southampton tätig war, muss es in diesem Zeitraum gewesen sein, dass er deren Partnerprogramm mit der Dalian Polytechnic University begleitete und in dem Zuge in China war (vgl. S. 130–32).
Sein „Global Contemporary Art World“ versteht Harris als dritten Teil „in my trilogy exploring the character, history and meaning of art made in the 20th and 21st centuries“ (S. 5), nach „Globalization and Contemporary Art“ von 2011 und „The Utopian Globalists: Artists of Worldwide Revolution, 1919–2009“ von 2013 (vgl. S. 5–7). Ähnlich ambitioniert, wie das Gesamtunterfangen klingt, ist auch diese Abhandlung. Nach einer Einleitung bespricht er in sechs Kapiteln die fünf Kunstwelten von Hongkong, Südkorea, Indien, China und Palästina. Es folgt ein Fazit als Abschlusskapitel. In dem Kapitel über China (S. 127–154) geht er auf das Bildungssystem und den, wie er es nennt, „Contemporary Chinese Art Marketed for Global Consumption“ ein. Stets ist er bemüht, die Hintergründe aufzuzeigen. Seine Vermittlung springt von einem zum anderen Großbereich und bleibt recht oberflächlich. Nicht ganz sicher bin ich mir, ob er die Verwendung chinesischer Namen einfach missversteht oder tatsächlich Ai Weiwei durch die Benennung von „Weiwei“ als seinen Buddy ansieht. Beides würde ich ihm nach der Lektüre zutrauen. Das Kapitel über Hongkong (S. 35–64) beschäftigt sich insbesondere mit dem Kunstmarkt und geht im Zuge des M+ Museums auch auf Privatmuseen vor allem in Shanghai ein (S. 48–50). Dieses Buch kann nur unter Vorbehalt empfohlen werden, ist aber als subjektive Einschätzung des Autors durchaus interessant. Sympathisch bleibt, dass Harris Utopien nachzujagen scheint.
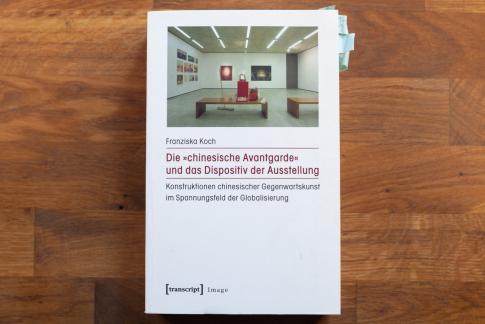
Koch, Franziska (2016): Die „chinesische Avantgarde“ und das Dispositiv der Ausstellung. Konstruktionen chinesischer Gegenwartskunst im Spannungsfeld der Globalisierung. Bielefeld: transcript.
Dieses Buch umfasst 742 Seiten, es ist größer als die Standardgröße bei Transcript und recht eng bedruckt. Es handelt sich um die kunsthistorische Dissertation von Franziska Koch, die sie 2012 im Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg abgegeben hat. Es gab eine Druckkostenförderung, aber ich bin immer wieder begeistert, was für Nischenprodukte beim Transcript Verlag zu finden sind. Die ebenfalls dort publizierte Dissertation von Meng Schmidt-Yin (2019): „Private Museen für Gegenwartskunst in China: Museumsentwicklung in der chinesischen Kultur- und Gesellschaftstransformation“ kann man sich leider getrost schenken. Doch Kochs „Dispositiv der Ausstellung“ ist eine echte Perle.
Es handelt sich um eine Untersuchung von zwanzig Großausstellung zur chinesischen Gegenwartskunst von 1982 bis 2014, die außerhalb von China im Westen stattgefunden haben. Sie stellt die jeweiligen, wie sie sie nennt, Agenten vor, ihre Institutionen und Diskurse und setzt die Ausstellungen ins Verhältnis zur innerchinesischen Entwicklung. Sie macht kleine Fehler und ihr unterlaufen marginale Ungenauigkeiten, die man bemerkt, wenn man eine Sache selbst recherchiert hat. Aber im Großen und Ganzen ist dies ein fulminant gelungenes Nachschlagewerk relevanter Ausstellungen und ihrer, wie ich sie nenne, Akteure.
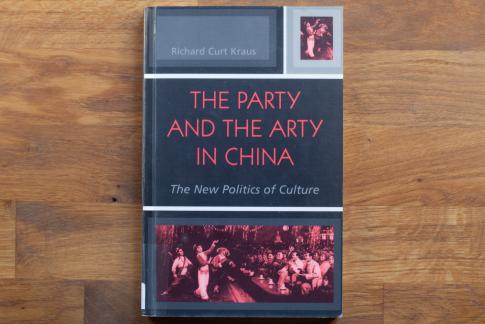
Kraus, Richard Curt (2004): The Party and the Arty in China: The New Politics of Culture. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
Seit Erscheinen dieses Bandes 2004 hat sich natürlich einiges verändert. Dieses Buch bleibt dennoch relevant für die direkte Verbindung von Kunst und Politik und für das Verhältnis zwischen Künstler:innen und der Politik. Richard Kraus ist inzwischen emeritierter Professor der Politikwissenschaften für Asienstudien der University of Oregon. Sein Fokus waren die vergleichenden Politikwissenschaften, chinesische Politik und Kulturpolitik.
Kraus beschreibt die Kulturpolitik in China in ihrem Wandel von der Zeit unter Mao als Staatskunst über die Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping hin zur Marktwirtschaft. Der Boom des Kunstmarktes hatte 2005/06 seinen ersten Höhepunkt, der mit der Weltwirtschaftskrise 2008 nicht wirklich einbrach – zwar zogen sich die Sammler aus dem Westen zurück, aber dafür betraten die chinesischen Sammler das Feld, alsbald danach auch das internationale. 2004 war Kraus diesem Phänomen bereits auf der Spur, es muss in der Luft gelegen haben, die Nullerjahre, so auch Karen Smith in „Art Unlimited?“ (s. unten Schultheis et al., S. 81), „the first decade of the 21st century was all about economics“. Kraus geht von drei Thesen aus: erstens der intellektuellen Liberalisierung durch Kommerzialisierung, die gleichzeitig Künstler:innen vor wachsende Herausforderungen stellte; zweitens dem Wandel zu einem gemischten System privater und öffentlicher Förderung – auf öffentlicher Ebene steht leider immer noch einiges aus –, wobei sein Punkt eher ist, dass Wirtschaftsreformen ernsthafte politische Reformen bedeuteten; und – mittlerweile relativiert – die westliche Anerkennung der Reformen in China, die – wobei, weiterhin vorhanden – in der Westperspektive durch eine Kombination aus „ignorance, ideological barriers, and foreign policy rivalry“ (S. vii) verschleiert betrachtet werde. Außerdem geht er Fragen der Ideologie, Propaganda und vor allem der Zensur nach. Sein ganzes Kapitel zur Nacktheit mutet etwas überholt an, ist als Hintergrund aber sinnvoll. Es bleibt ein Werk, das gut gealtert ist und in dem man weiterhin einiges nachschlagen kann.
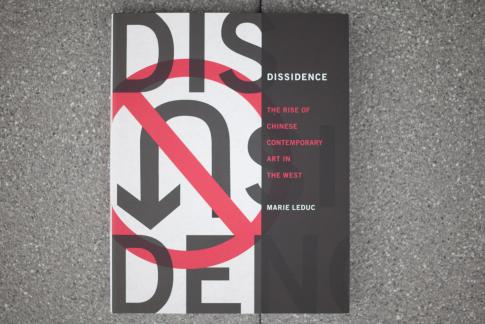
Leduc, Marie (2018): Dissidence: The Rise of Chinese Contemporary Art in the West. Cambridge, Mass.: MIT.
„Dissidence“, Opposition und Widerspruch klingen als Übersetzung eher harmlos, Dissens von Dissident:innen, es handelt sich um einen Begriff, mit dem man in Bezug auf restriktive Systeme stets Aufmerksamkeit erwecken möchte und der deshalb diesem Beigeschmack nicht entrinnen kann. Noch schlimmer ist Dissidentenkunst, aber über Ai Weiwei sind wir ja auch hierzulande nach seinem Berlinaufenthalt glücklicherweise hinweg. Nicht, dass ich gegen Konfrontation wäre, beileibe nicht. Sie findet in China nur anders statt, auch, aber nicht immer so direkt-plakativ, dass man sie im Westen sofort versteht, traditionell sowieso eher zwischen den Zeilen. Marie Leduc spricht dieses Thema nicht so platt abwertend wie ich an, aber auch ihr geht es um die Sehnsucht des Westens nach politischer Provokation, die nach dem Tian‘anmen Massaker 1989 begann und sich daraufhin verstärkte. Dafür steht der Verweis des Emblems auf dem Cover, das von der „China/Avant-Garde“-Ausstellung 1989 in Beijing stammt, im Februar, als man sich noch frei wähnte und die Avantgarde war. Ab Juni 1989 wurde der Westen aufmerksam, in China selbst zog man sich vermehrt zurück. Zunächst fragt Leduc nach dem Wert des Dissens in der Kunst und stellt Künstler:innen vor, die als Dissident:innen bekannt wurden. Sie untersucht die Ausstellung „Magiciens de la Terre“ von 1989 im Centre Pompidou, einer frühen Ausstellung gegen die eurozentrische Perspektive mit Arbeiten von hundert zeitgenössischen Künstler:innen aus aller Welt – nagut, immer noch eher Künstlern, aus China waren Huang Yongping, Gu Dexin und Yang Jiechang dabei. Mit dem Vermächtnis auch dieser drei als der Avantgarde hinterfragt sie weitere Themen wie Kunst und Revolution (als Dissens), freie Meinungsäußerung und Gegenwartskunst im Zuge der Globalisierung. Ich bin des Themas ein wenig müde, es bleibt leider weiterhin notwendig, dafür gibt es zu wenige – jetzt möchte ich Direktheit – Primärstimmen aus China.
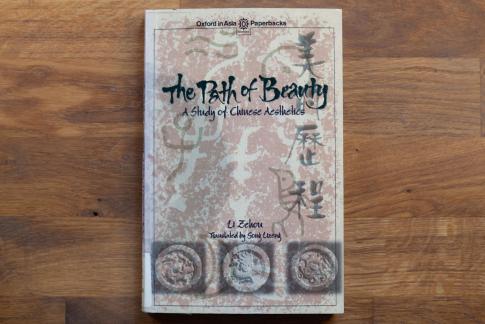
Li Zehou 李泽厚 (1994 [1981]): The Path of Beauty: A Study of Chinese Aesthetics (Original: 美的历程). Übersetzung: Gong Lizeng. Hongkong und New York: Oxford UP.
Li Zehou (1992): Der Weg des Schönen: Wesen und Geschichte der chinesischen Kultur und Ästhetik. Übersetzung: Karl-Heinz Pohl und Gudrun Wacker. Freiburg im Breisgau u. a.: Herder.
Es gibt wirklich hässliche Coverdesigns. Li Zehou trifft keine Schuld, alle chinesischen Versionen sind um Meilen angenehmer, so auch die deutsche Ausgabe von 1992 und das englische Hardcover von 1989. Nur noch antiquarisch und einigermaßen erschwinglich blieb mir dieses ehemalige Bibliotheksexemplar. Kann das irgendjemand ernst meinen, selbst Mitte der 1990er Jahre, selbst als akademische Publikation, vor allem aber bei einem Buch über Ästhetik? Wenigstens existiert kein Hinweis auf das Grafikbüro. Es handelt sich um ein Standardwerk, das nicht wegen des Covers, sondern seines Inhalts gekauft werden sollte. Man muss sich nur überwinden, es aufzuklappen, dann verschwindet die hellbraune Verstörung von selbst.
Wie oben Chengs „Fülle und Leere“ und unten Zhus „Philosophie“ habe ich Lis „Path“ als Hintergrund hier aufgenommen, der dabei hilft, durch die Tradition die Gegenwart einzuordnen. Es existieren etliche wunderbare Abhandlungen zur traditionellen chinesischen Malerei, allgemeine Sammelbände über Kunst in China, häufig in gewaltigen Schritten durch die einzelnen Kaiserreiche schreitend. Diese drei exemplarischen Werke ermöglichen einen Einblick in die Gedankenwelt des alten China und dessen künstlerische Herangehensweisen, die chinesischen Künstler:innen auch heute noch präsent sind.
Chronologisch aufgebaut, beginnt diese Abhandlung mit dem mythologischen Zeitalter der „Drachen und Phönixe“, der Bronzezeit und Prä-Qin bis zur Einigung des Landes unter dem ersten Kaiser. Stets kunsthistorisch, also mit historischen Hintergründen und sozialen Veränderungen, begibt Li sich dann in die Zeit, die er die „Romantik der Chu und Han“ nennt. Durch die Epochen wandernd, sortiert er unterschiedliche Stilrichtungen, bespricht buddhistische Einflüsse, die Hochphase der Tang, die Vorstellung von Rhythmus und wie damit umgegangen, darüber hinausgegangen wird, wie es zur wichtigen Phase der Landschaftsmalerei der Song kam. Kunst und Literatur als Künste zusammen betrachtend, schließt Li mit den Haupttrends in der Ming- und Qing-Dynastie, er endet mit dem Ende des Kaiserreiches mit den Einflüssen der Umgangssprache und reflektiert über die Kunst als Handwerk. Die nur gut 230 Seiten liefern eine empfehlenswerte Grundlage zum Verständnis von Kontext und Entwicklung der Künste.
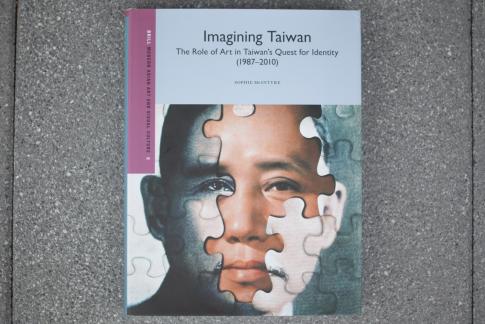
McIntyre, Sophie (2018): Imagining Taiwan. The Role of Art in Taiwan‘s Quest for Identity (1987–2010). Leiden und Boston: Brill.
Selbst war ich noch nie auf Taiwan und habe keine Ahnung von dem Land. Eine Übersetzung für das Palastmuseum in Taipei war bislang mein einziger direkter Kontakt mit der abtrünnigen Insel aus meiner Festlandsperspektive. Letztens meinte eine Freundin, sie würde gerne hin, wenn das Reisen denn wieder möglich wird, solange Taiwan, so ergänzte sie quasi prä-nostalgisch, noch Taiwan sei. Die Australierin Sophie McIntyre kennt Taiwan. Sie ist Kuratorin und Dozentin an der Queensland University of Technology. „Imagining Taiwan“ basiert auf ihrer Dissertation, die sie, eine Jahresangabe ist nicht zu finden, an der Australian National University eingereicht hat. Die vorliegende Abhandlung habe sich über zwanzig Jahren hinweg entwickelt. Es geht um die Kunst taiwanesischer Künstler:innen, um Museumspolitik, Identität und Anerkennung, anhand von Fallstudien um die Dekonstruktion, die Erzählbarkeit, um die Identitätsbildung und Entmythologisierung des Begriffs und Verständnisses von Nation. Weiter geht es um den Aufstieg Chinas und die Notwendigkeit der Neuorientierung Taiwans, hier werden etwa die Biennalen in Taipei und Venedig gegenübergestellt. Das Buch hat beinahe das Format eines Ausstellungskataloges, es ist reich bebildert und man merkt ihm die Kuratorin an.
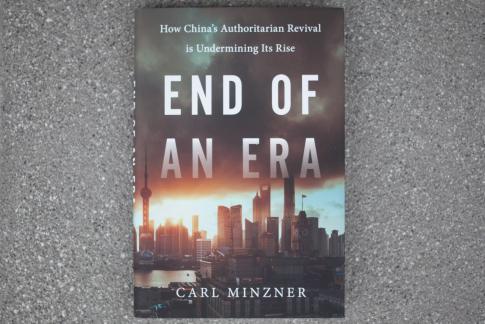
Minzner, Carl (2018): End of an Era: How China‘s Authoritarian Revival is Undermining Its Rise. New York: Oxford UP.
Auch dieses Werk bietet einen Hintergrund, in diesem Fall einen politisch-gesellschaftlichen. Mit dem titelgebenden Ende einer Ära ist die unter Deng Xiaoping begonnene Reformära gemeint, und da jedem Ende ein Anfang innewohnt, bezieht sich dieser gleichzeitig auf den Beginn der Neuen Ära von Xi Jinping. Der amerikanische Juraprofessor Carl Minzner ist auf chinesisches Recht und Governance in China spezialisiert und charakterisiert hier die Kernfaktoren im Wandel von Ende und Anfang. Diese beinhalten politische Stabilität, ideologische Öffnung und rasantes Wirtschaftswachstum. An der Oberfläche erscheine es, dass Chinas Führung sich einer tiefgreifenden Reform seit den 1990ern verweigert habe. Während um das Land und weltweit Aufruhr herrsche, erscheine China als stabil und in stetigem Aufschwung. Doch seit den letzten dreißig Jahren habe ein erstarrtes politisches System die fest verwurzelten Interessen innerhalb der KPCh und die systematisch unterentwickelten Regierungsinstitutionen angetrieben. Wirtschaftliche Spaltungen haben sich genauso vermehrt wie soziale Unruhen und ideologische Polarisierung. Der Umgang damit sei ein progressives Ausschlachten institutioneller Normen und Praktiken von Seiten der Führungsebene. Die technokratische Führung weiche dem, was Minzner Blackbox-Säuberungen nennt, und das kollektive Regieren falle zurück auf eine Ein-Personen-Herrschaft. Die Reformära der Öffnungen sei beendet, China mache dicht. Minzner betrachtet dies unter den Aspekten Gesellschaft und Wirtschaft, Politik, Religion und Ideologie sowie in vergleichender Perspektive insbesondere zu Taiwan und Südkorea. China stehe an einem gefährlichen Wendepunkt. Am Ende seines Buches spielt Minzner mögliche Zukunftsszenarien durch, den Untergang des liberalen Traums, die Weiterführung autoritärer Führung, die Verstärkung des Nationalpopulismus, eine Wiederbelebung des dynastischen Zirkels, einen Zusammenbruch des Regimes und verschiedene Möglichkeiten weltweiten Umgangs damit.
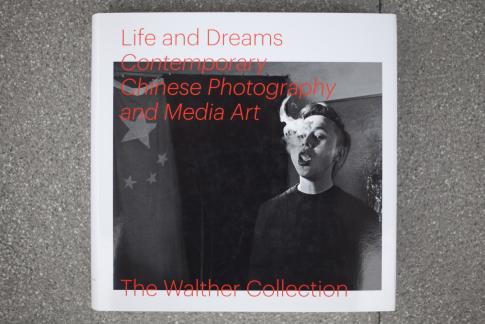
Phillips, Christopher und Wu Hung (Hgg.) (2018): Life and Dreams: Contemporary Chinese Photography and Media Art. New York und Göttingen: The Walther Collection und Steidl.
Vor mir liegt ein sehr schöner, dicker Bildband mit einer Zusammenstellung von knapp fünfzig Fotograf:innen. Es handelt sich insbesondere um bekannte Namen wie Cang Xin, Cao Fei, Hong Hao, Rong Rong, Song Dong, Sun Xun, Wang Gongxin, Yang Fudong, Zhang Dali, Zhang Peili, Zhou Tiehai, Zhuang Hui und vielen mehr. Jede/r Fotograf:in erhält meist drei, mal eins, mal fünf Bilder Platz, die Titel finden sich gesondert am Ende, wodurch keine Ablenkung von den Bildern entsteht. Wie es sich gehört, finden sich ebenfalls am Ende die Biografien der vorgestellten Künstler:innen. Ergänzt wird dieser Band mit einer Reihe von Essays, etwa von Wu Hung mit seinem Ruinenansatz, Rong Rong zur Avantgarde-Fotografie, Karen Smith über Aufklärung durch die Linse, Lu Yang zu neuen Medien und anderen. Es sind keine neuen Positionen zu erwarten, aber ein guter Überblick des Bekannten.
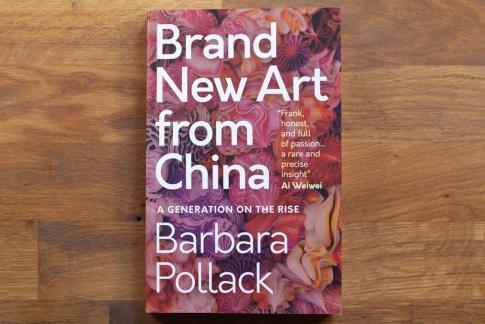
Pollack, Barbara (2018): Brand New Art from China: A Generation on the Rise. London und New York: I.B. Tauris.
Barbara Pollack, Journalistin (New York Times, ARTnews), Kunstkritikerin und Kuratorin (in China etwa im Yuz Museum und im Long Museum), schreibt neben anderen Themen seit gut fünfzehn Jahren über die Kunstszene in China. So verfasst sie seit Mitte der 2000er Artikel über Ai Weiwei – weshalb vermutlich ein Zitat von ihm ihr „Brand New Art“-Cover ziert. Davon sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen. Mit teils etwas rudimentären, aber anschaulichen Einschätzungen zur kulturellen, politischen und gelegentlich historischen Lage, vor allem aber mit vielen Beispielen von Künstler:innen ab der 1980-Generation basiert Pollacks Buch auf Gesprächen mit den Akteur:innen der Szene. Die thematische Unterteilung ist grob chronologisch und beschäftigt sich etwa mit Chineseness, Abstraktion, Post-Truth und Post-Internet Kunst und endet in New York. Ai kommt auch vor, der Fokus richtet sich aber auf die Generation von Cao Fei und jünger. Pollacks Darstellung bietet eine kurzweilige Momentaufnahme insbesondere der Metropolkunst in China der 2010er Jahre.
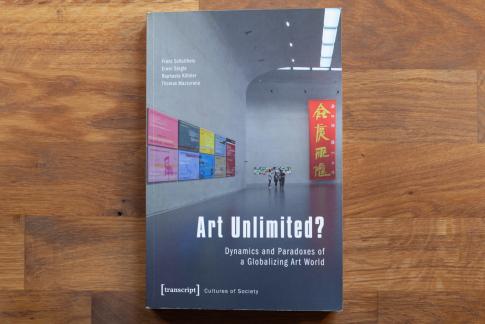
Schultheis, Franz, Erwin Single, Raphaela Köfeler und Thomas Mazzurana (2016): Art Unlimited? Dynamics and Paradoxes of a Globalizing Art World. Bielefeld: transcript.
Man ist doch immer wieder überrascht, wie viele Leute ohne jegliches Vorwissen in ein fremdes Land gehen, sich dort ein paar Monate oder ein Jahr aufhalten und dann ein Buch darüber schreiben. Häufig erschauern einen die getroffenen Aussagen, genauso häufig ist man erstaunt, wie viele der relevanten Kontakte ausfindig gemacht wurden. Vermutlich ist die Szene wirklich so klein, die leichte oder schwierige Zugänglichkeit mag eine Charakterfrage sein – oder berufsbedingt.
Die Autoren dieses Bandes sind alle Soziologen, die sich offensichtlich erstmals mit China beschäftigen. Es handelt sich um eine Sammlung von Interviews mit Kurator:innen, Galerist:innen, Sammler:innen und ähnlichen Akteuren, die 2013/14 im Zuge eines Studienprojektes der Universität St. Gallen geführt wurden. Es ist ganz lustig, wie immer wieder ähnliche Fragen gestellt werden. Offensichtlich sind die Autor:innen die gesamte Zeit dabei, das Phänomen zu verkraften, dass chinesische Sammler:innen, zumindest wenn sie gerade mit dem Sammeln beginnen, sich zunächst über die Auktionshäuser – und nicht wie im Westen primär über Galerien – dem Markt nähern. Auch sonst drehen sich viele Fragen um das Marktverständnis. Die Autor:innen scheinen ihren Hauptzugang über die Art Basel in Hongkong erhalten zu haben und von dort losgezogen zu sein. Lesenswert sind besonders die Interviews mit Karen Smith (damals Beijing, heute Xi‘an, vermutlich bald Shanghai), Robin Peckham (damals Hongkong), Colin Chinnery (Beijing) und Tobias Berger (damals Hongkong). Vor allem Meg Maggio (Beijing) und Gu Ling (damals Shanghai) setzen einiges an Westlerperspektive der Autor:innen zurecht, was sich ganz amüsant liest.
Um die bei Kraus oben bereits zitierte Stelle von Karen Smith aufzugreifen, hier ihre sehr schön prägnante Einordnung der jeweiligen Dekaden (S. 81): „The 80s was pervaded by a kind of freedom; the 1990s was very political. Suddenly, the first decade of the 21st century was all about economics. This second decade feels rather flat. Perhaps it is needed as a period to reflect and put everything in perspective. Out of that, some new, stronger contemporary cultural identity will emerge for the 2020s, which will be tied to what will happen in China as China‘s position in geopolitics becomes ever more clearly defined.“
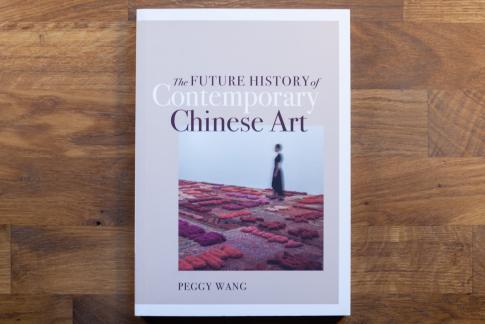
Wang, Peggy (2020): The Future History of Contemporary Chinese Art. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Der Ansatz von Peggy Wang ist ganz interessant. Hier geht es um die international renommierten Künstler:innen der 1950er/1960er-Generation Zhang Xiaogang, Wang Guangyi, Sui Jianguo, Zhang Peili und Lin Tianmiao. Auch hier geht es (wie oben bei Leduc) zunächst, da auf Englisch und entsprechend hauptsächlich für ein westliches Publikum geschrieben, nicht um, sondern gegen die westliche Suche nach Sozial- und Politikkritik bei Dissidenten. Diese ist in den besprochenen Kunstwerken auch vorhanden, aber natürlich steckt viel mehr dahinter. Als „Zukunftsgeschichte“ bezeichnet Wang ihre Neuinterpretationen in Form, Bedeutung und Möglichkeiten der Werke für sich und in Bezug auf die Kunstgeschichte in China und global. Sie legt die häufigen Fehllesungen dar, auch der Künstler:innen selbst, etwa in Bezug auf den Westen. Außerdem geht es gelegentlich um die Einflüsse, die diese fünf Künstler:innen auf andere genommen haben.
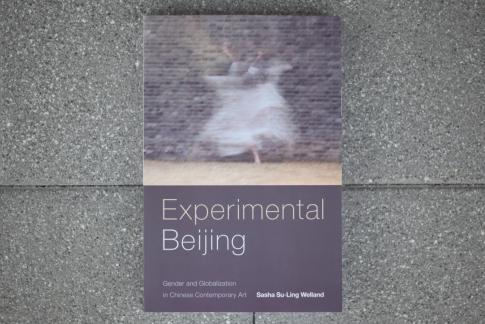
Welland, Sasha Su-Ling (2018): Experimental Beijing: Gender and Globalization in Chinese Contemporary Art. Durham und London: Duke UP.
Als ethnografische Feldarbeit beschreibt Sasha Welland ihre Untersuchung, die sie unter der Prämisse der Kommerzialisierung besonders von experimenteller Kunst vorgenommen und seit und auf die Olympischen Spiele 2008 zugehend wahrgenommen hat. Entsprechend lässt sie Stimmen von Künstler:innen, Kurator:innen, von offizieller Seite und von Stadtplaner:innen zu Wort kommen. Diese tarieren die soziale Rolle von Kunst aus und beschäftigen sich mit dem Aufbau neuer Kulturinstitutionen. Welland vertritt die These, dass Genderthemen ein verändertes Bewusstsein der Kunstgeschichte in China herbeiführen würden, die Globalisierung scheint als Dialog gemeint. Klar, für China nicht aber doch recht gewagt? Da mir genderspezifische Themen in China bislang nur eher am Rande untergekommen waren, lese ich natürlich gerne mehr davon. Vor allem ihre Einordnung von Begriffen und besonderen Pop-up-Phänomenen finde ich ganz interessant.
Zu dieser Druckversion hat Welland ein kleines digitales Kompendium geschaffen.
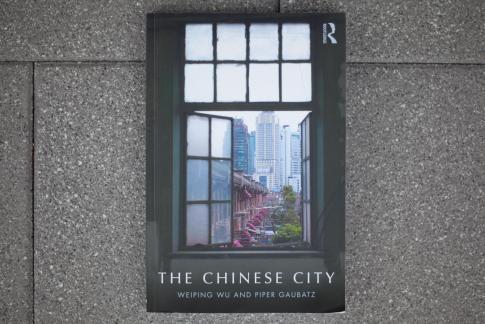
Wu, Weiping und Piper Rae Gaubatz (2013): The Chinese City. London und New York: Routledge.
Hier geht es nicht um Kunst, sondern um Stadtentwicklung in China – einem äußerst wichtigen, da lebensessentiellen Thema der chinesischen Gegenwart und damit in der Gegenwartskunst und deshalb eine passende Ergänzung in dieser Liste. Obwohl diese Abhandlung bereits ein wenig älter ist und etwa die Abrisswucht unter Xi Jinping insbesondere von 2017 in Beijing noch nicht miterleben musste (s. als Beispiele aus Beijing hier, hier oder hier), bietet sie reichlich Material zum strukturellen Verständnis chinesischer Städteplanung. Wu und Gaubatz liefern fundierte Hintergründe, nicht nur, aber auch an historischem Kontext und geografischer Kulisse. Mit zahlreichen Statistiken, meist von 1949 bis 2009, beleuchten sie das Urbanisierungsphänomen, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation, der Infrastruktur sowie der Land- und Hausreformen und -bedingungen. Sie hinterfragen den urbanen Lebensstandard unter zivilgesellschaftlichen Gesichtspunkten und die urbane Governance. Ich habe bereits die eher architektonische Sicht von Dieter Hassenpflug (2009): „Der urbane Code Chinas“, Basel und Berlin: Birkhäuser, mit Gewinn gelesen, es gibt auf diesem Gebiet natürlich zahlreiche Essays und für mich handelt es sich eher um ein Hobbythema, dennoch finde ich, dass Wu und Gaubatz hier ein bemerkenswertes Fundament bieten.
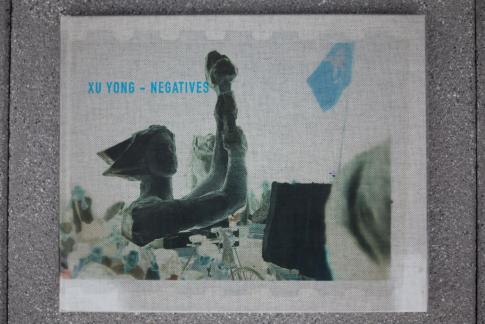
Xu Yong 徐勇 (2015): Negatives. Dortmund: Kettler.
Gerade jährte sich das Tian‘anmen Massaker am 4.6.2021 zum 32. Mal. Zum ersten Mal gab es dieses Jahr kein offenkundig öffentliches Mahnmal in Hongkong. Der Fotograf Xu Yong hatte 1989 etliche Filmrollen auf dem Platz des Himmlischen Friedens belichtet. Er ließ sie über zwanzig Jahre in den Tiefen seiner Schubladen ruhen. Auch für diese Publikation im Ausland von 2015 wählte er nicht den direkten Weg der Positiventwicklung, das Thema war und ist einfach noch viel zu heikel. Mit einer einfachen Einstellung lassen sich die Bilder auf dem Handy im Positiv betrachten, tatsächlich changieren aber die negative Fotoästhetik und der dadurch gewonnene Abstand auf ihrer ganz eigenen Skala von Schönheit und Grauen.
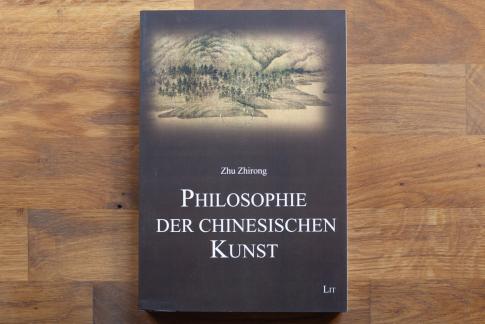
Zhu Zhirong 朱志荣 (2020 [2012, 1997]): Philosophie der chinesischen Kunst (Original: 中国艺术哲学). Übersetzung: Eva Lüdi Kong. Berlin: LIT.
Wie oben bereits geschrieben, habe ich diese Abhandlung genauso wie Chengs „Fülle und Leere“ und Lis „Path of Beauty“ mit aufgenommen, weil sich Gegenwarten durch Blicke auf Vergangenheiten und ihre Traditionen erhellen.
Man könnte sagen, dass es sich um die Neuauflage von Lis „Path of Beauty“ handelt. Hier erfolgt allerdings anstelle der chronologischen eine thematische Unterteilung. Diese ist sehr detailliert, was den großen Reiz des Buches ausmacht. Allein durch das ausschweifende Inhaltsverzeichnis erhält man einen guten Einblick in das Themenfeld der chinesischen Ästhetik und Gedankenwelt.
Die Einordnungen „zur energetischen Wirkung und geistigen Ausstrahlung“ seien von daoistischen und konfuzianischen Weltanschauungen durchdrungen, weshalb diese Abhandlung mit „Philosophie der chinesischen Kunst“ betitelt sei (S. i). Die Kunsttheorie des alten China wird mit ihren eigenen Kategorien dargestellt. Die fünf Kapitel („Das künstlerische Selbst“, „Kunst an sich“, „Besondere Eigenschaften“, „Geistiger Ausdruck“ und „Entwicklungsgeschichte“) sind in angenehme kleine Häppchen unterteilt. Nach der Herangehensweise, den schöpferischen Quellen, dem Umgang mit Ruhe, Erkennen und Vitalität, werden Bedeutung, Form, Struktur, Rhythmus, Bildgestalt, Resonanz und vieles mehr behandelt. Zhu geht auf das Verständnis von Zeit und Raum, Innen- und Außenwelt, Subjekt und Objekt ein, und es folgen immer wieder Abschnitte zu den grundlegenden Eigenschaften. Die zahlreichen Zitate der Dichter und Denker werden stets in Kontext gesetzt und bilden mit der poetischen Denkweise der Dichtkunst die Basis zu den Erklärungen und Einordnungen. Die Begriffe, Personen und Werke sind durchweg auch auf Chinesisch wiedergegeben, Eva Lüdi Kong lebe hoch. Leider muss dieses Buch ganz ohne Abbildungen auskommen.
Romane aus und über China
Ich behaupte immer, nie Krimis zu lesen, und auch Scifis machen bei mir normalerweise keine 4/5-Romanration aus. Hier gibt es von mir einen Krimi und vier Sciencefiction-Romane, alle fünf taugen genauso wunderbar als Lockdown- wie als sommerliche Urlaubslektüre.
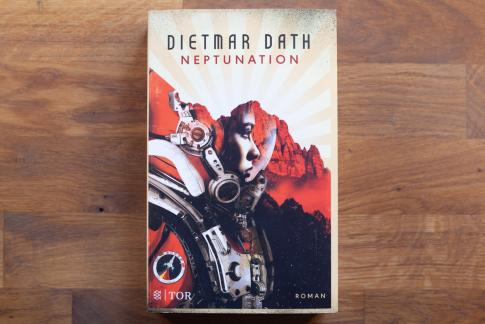
Dath, Dietmar (2019): Neptunation. Frankfurt a. M.: Fischer Tor.
In diesem Scifi bricht ein deutsch-chinesisches Rettungsteam dreißig Jahre nach Ende des Kalten Krieges auf, um dem Signal einer damals von der Sowjetunion und der DDR entsendeten Mission nachzugehen.
Neben der marxistischen Grundeinstellung hat mich besonders gefreut, dass der Beijinger Künstler Wang Guangle hier einen kurzen Auftritt hat, S. 290f. Es geht bei der „schwebende[n], konvex elliptische[n] Form aus weißer Farbe“ um Wangs Arbeit, die er 2011 in der Beijing Commune im 798 ausgestellt hat (s. hier). Einerseits soll die Arbeit nicht interpretiert werden, „also bitte keine Kunstvorträge jetzt von Cordula, dass das irgendwie das Unbewusste der Macht oder die Dialektik der Arbeitsteilung oder so was darstellt“, andererseits erinnere diese Arbeit „uns nicht an das, was wir sind, sondern lässt uns vergessen, wo wir sind: im Weltraum, wo es nicht nur keine Kunst gibt, sondern nicht mal was zu essen“. Den einen oder anderen Dath kann man sich unbedingt gelegentlich gönnen.
Passenderweise lief kürzlich ebenda wieder eine Soloshow von Wang: „Wang Guangle 王光乐: Waves 波浪“, in: Beijing Commune 北京公社, 15.4.–28.5.2021.
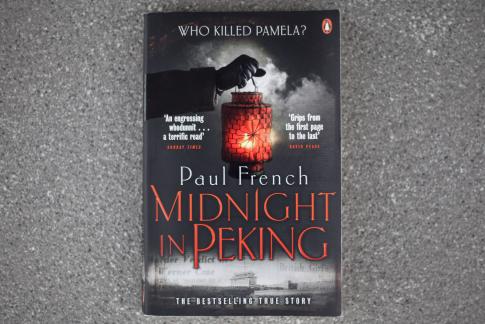
French, Paul (2012 [2011]): Midnight in Peking. The Murder That Haunted the Last Days of Old China. London: Penguin.
Der Brite Paul French lebte um 2010 zehn Jahre in Shanghai, spricht Chinesisch (das muss leider immer noch gesagt werden) und schreibt als Journalist und Schriftsteller über Gesellschaft und Geschichte in China, mit Fokus auf das Ende des Kaiserreichs und die Republikzeit. „Midnight in Peking“ ist eine Dokufiktion über den unaufgeklärten Mord an der jungen Britin Pamela Werner im Jahr 1937 im Gesandschaftsviertel von Beijing. Es geht um das Leben der damaligen Expats, um Gesandte, Händler und andere Lebenskünstler, in Konfrontation mit der chinesischen Polizei zu Beginn der japanischen Invasion vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Mit, so Frenchs Erzähler, bislang unbekannten Dokumenten wird der Mord gar aufgedeckt ? Wie auch in seinen anderen Büchern, scheint French den Duktus der damaligen Zeit glaubwürdig zu beherrschen. Es ist ein Genuss, ihm durch die Hutongs und die Stadtmauern entlang zu folgen.
Berichten zufolge (Forbes 2012, 澎湃 2019) wird gelegentlich über eine Verfilmung von „Midnight in Peking“ spekuliert – ich würde mich sehr darüber freuen.
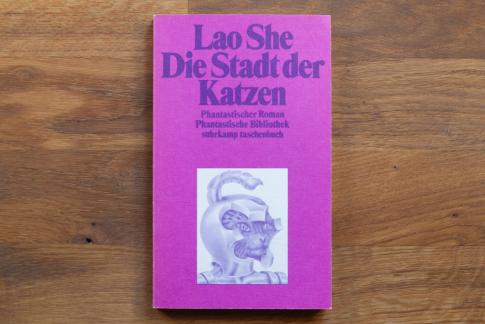
Lao She 老舍 (1985 [1933]): Die Stadt der Katzen (Original: 猫城记). Übersetzung: Volker Klöpsch. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Wer noch nichts von Lao She gelesen hat, dem sei besonders dieser Scifi empfohlen – oder auch Gesellschaftsroman, darüber streiten sich die Geister. Zumindest spielt er auf einem fernen Planeten mit Katzen als Bewohnern. Das Gesellschaftsbild ist so wunderbar auf Lao Shes Zeit übertragbar wie auf die heutige, aber das soll bei Scifis ja gelegentlich auch der Fall sein.

Liu, Cixin 刘慈欣 (2017 [2006]): Die drei Sonnen (Original: 三体). Übersetzung: Martina Hasse. München: Heyne.
Teil 1 der Trilogie.
Teil 2: Der dunkle Wald (2018 [Original: 黑暗森林, 2008]), Übersetzung: Karin Betz.
Teil 3: Jenseits der Zeit (2019 [Original: 死神永生, 2010]), Übersetzung: Karin Betz.
Liu Cixins Trilogie braucht kaum noch eine Vorstellung, so allgemein bekannt ist dieser Scifi. Der dritte Teil erschien mit einer leider immer holpriger werdenden Übersetzung auf Deutsch bereits vor Corona, ich habe ihn damals natürlich sofort gelesen. Der erste Teil bleibt der stärkste und, wenn man Cliffhängern widerstehen kann, besonders lesenswert. Andererseits sollte dazu unbedingt der zweite Teil gelesen werden, denn wer möchte schon die Theorie des dunklen Waldes in seinem Leben missen? Wer auf sich aufmerksam macht, wird angegriffen, bevor er/sie angreifen kann – gibt es in Lius Version natürlich um Seiten länger und Bildlängen grandioser.
Als Einschätzung aus sehr deutscher Perspektive sei die Podcastfolge von Kapitel Eins: Die drei Sonnen von 2018 empfohlen.
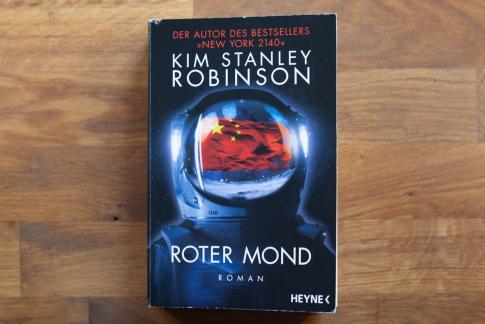
Robinson, Kim Stanley (2019 [2018]): Roter Mond (Original: Red Moon). München: Heyne.
Leider sollten Scifis (zumindest die von Heyne publizierten?) wohl im Original gelesen werden, kein Wunder, dass das Genre nicht als Hochliteratur bekannt ist. Aber wenn man sich durch den gruseligen Anfang gebissen hat, weil man wieder zu faul war, sich technischen Erklärungen auf Englisch, geschweige denn auf Chinesisch zu stellen, dann hat man sich an die Schreibe gewöhnt und kann über Hunderte von Seiten in fremde Welten abtauchen.
2048 hat China hier die Vorherrschaft in der Kolonisierung des Mondes übernommen, weshalb er der Rote Mond genannt wird. Vielleicht haben Xi Jinpings Taikonauten Robinson gelesen, bevor sie Anfang 2019 auf der Schattenseite unseres Trabanten landeten – dieser Plan war wahrscheinlich bereits vorher gereift, aber auch verkündet? Und was haben sie dort wirklich angestellt? Bei Robinson befindet sich auf der Schattenseite des Mondes etwa ein unterirdisches, einem traditionellen chinesischen Landschaftsgemälde nachempfundenes Gelände. Die Chinesen wissen hier einfach nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ein Mord auf dem Mond verbindet einen alten chinesischen Dichter, der inzwischen nur noch Videoblogs publiziert, eine chinesische Kadertochter und einen amerikanischen Techy miteinander. Natürlich geht es auch hier letztendlich um die Rettung der Welt.
„Inzwischen waren die Generationen, die bis zur ersten um Mao zurückreichten und zu der Zhou Enlai, Deng Xiaoping und die anderen Acht Unsterblichen gehört hatten, eher eine nominelle Angelegenheit. Die Folgegenerationen wurden lediglich anhand der jeweiligen Generalsekretäre, der Parteikongresse und des gesetzlichen Rücktrittsalters durchnummeriert. Unterm Strich kam dabei heraus, dass heutzutage alle zehn bis zwanzig Jahre eine neue Führungsgeneration antrat. Im Prinzip handelte es sich um einen ziemlich konstruierten Begriff, aber trotzdem wurde er oft verwendet und kombinierte die chinesische Vorliebe für nummerierte Listen mit einem allgemeineren menschlichen Bedürfnis nach einer Periodisierung der Geschichte, in dem hoffnungslosen Versuch, den menschlichen Geschicken einen Sinn abzuringen, indem man eine Art Feng Shui mit der Zeit betrieb.“ (S. 182f.)
Im Prinzip erwarte ich eher, dass Xi bis 2048 durchregiert, dann wäre er 95 Jahre alt, das halte ich nicht für abwegig. Und ist eine generative Nummerierung spezifisch chinesisch? Andrew Batson ist in „How plausible is the China in Kim Stanley Robinson‘s *Red Moon*?“, 2.3.2019, nicht überzeugt von Robinsons China-Vision, die er mehr als heutige Version mit etlichen Fehlern liest. Ich mochte das Buch trotzdem und fand es gerade wegen der Zustandsbeschreibungen von China aus amerikanischer Sicht interessant.
--
Aktuell werde ich gut unterhalten von Dana Spiottas (2008 [2006]): „Eat the Document“, Köln: KiWi; ohne China-Bezug.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Bücher 书籍, Bildende Kunst 美术, Literatur 文学
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 17. Juli 2019
Zum Zittern
youjia, 21:41h
Weiterhin soll die Zeit morgen und wieder Merkels Zittern thematisieren, 17.7.2019, Die Zeit, Nr. 30/2019, 18.7.2019.
Lest doch bitte alle Siri Hustvedt: Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2011.
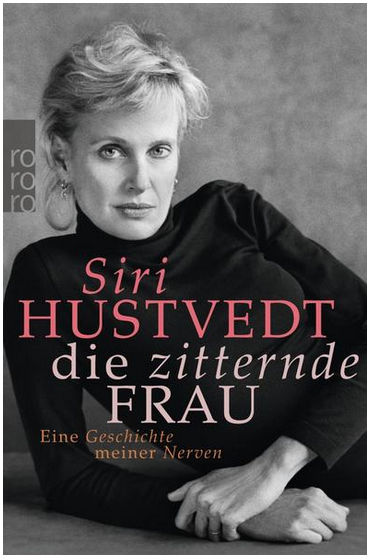
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Politik 政治, Deutschland 德国, Literatur 文学
Lest doch bitte alle Siri Hustvedt: Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2011.
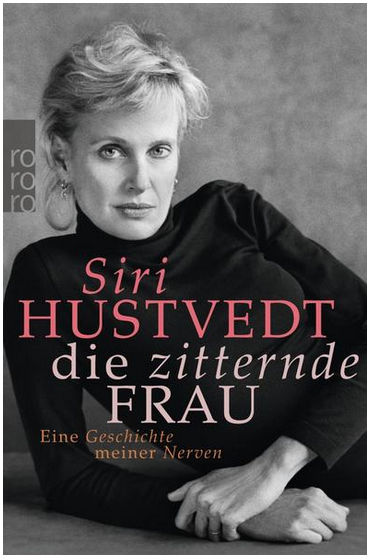
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Politik 政治, Deutschland 德国, Literatur 文学
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 4. Juni 2019
In Gedenken
youjia, 12:36h

30 Jahre nach Tiananmen – Wie politisch ist die chinesische Kunst?. Sabine Peschel: DW, 1.6.2019.
Political art in China 30 years after the Tiananmen Square protests. Sabine Peschel: DW, 2.6.2019.
30 years after the Tiananmen Square crackdown, dissidents in China and in exile speak to why the wounds still haven’t been healed. Lea Li: SCMP, Video, 3.6.2019.
... link (1 Kommentar) ... comment
Freitag, 1. September 2017
Warum Beijing statt Peking
youjia, 17:25h

Peking ist die Umschrift von einem früheren Namen der Stadt, von Beiping, nördlicher Frieden, als die Ming- die Yuan-Dynastie ablöste (1368). Der erste Ming-Kaiser, Hongwu (1328–1398), verlegte damals seine Hauptstadt in den Süden nach Nanjing und änderte den Namen Dadu des vorherigen mongolischen Hauptsitzes in Beiping. 1408 ließ Kaiser Yongle (1360–1424) die Stadt so gut wie komplett neu erbauen, es entstanden etwa die Verbotene Stadt und die vier Tempelanlagen Himmelstempel, Erdtempel, Sonnen- und Mondtempel. 1421 zog er dann in seine neue Hauptstadt um und nannte sie Beijing, die nördliche Hauptstadt. Warum sich die bis heute nicht auszumerzende Transkription auf den alten Namen einer Zeit von gerade einmal 53 Jahren von damals vor knapp 500 Jahren bezieht, als sie nicht einmal Hauptstadt war, mag eine der historischen Mysterien im Schlund der Gezeiten bleiben. Durch Beiping wurde jedenfalls die auf Wade-Giles basierende Umschrift „Peking“ zum Ausgang der Qing-Dynastie vom Transkriptionssystem chinesischer Ortsnamen der chinesischen Post 1906 bewilligt und blieb, wohl da einmal offiziell festgehalten und so ins internationale Postwesen eingegangen, bis ins 20. Jahrhundert haften.
Das heute geläufige Transkriptionssystem Hanyu Pinyin, kurz Pinyin, wörtlich umgeschriebene Töne, also phonetische Umschrift, wurde 1982 registriert und gilt seitdem als internationaler Standard, in seiner zweiten Auflage mit ISO 7098:1991, zuletzt national 2012 revidiert (GB/T 16159-2012). Das System auf Basis des lateinischen Alphabets stammt von 1956 von Zhou Youguang und wurde 1957 genehmigt. Auch auf Taiwan gilt Pinyin seit 2009 als offizieller Standard – inwieweit es dort angenommen wird, ist fraglich, Taipei wird auf der Insel weiterhin nicht in Taibei umgeschrieben, wenn überhaupt, denn nach wie vor ist die Umschrift Bopomofo verbreitet (die nicht-lateinische, auf dem Festland 1921 eingeführte Umschrift Zhuyin).
Selbst innerhalb der Sinologie hat es eine gute Weile gedauert, bis sich die Umschrift Pinyin durchsetzte. Dass wir noch in den Nullenjahren des 21. Jahrhunderts mit dem angelsächsischen Transkriptionssystem Wade-Giles und mit den deutschen Systemen von Unger und Rüdenberg-Stange klassisches Chinesisch gelernt haben, liegt am Referenzapparat. So heißt es im Studium auch heute weiterhin, „Wade-Giles soll zumindest passiv beherrscht werden“, s. Universität Heidelberg, Institut für Sinologie. Wissenschaftlich gilt natürlich wie überall: Hauptsächlich einheitlich. Aber außer in Zitaten schreibt mittlerweile jeder in Pinyin um.
Im angloamerikanischen Raum spricht man Beijing längst nicht mehr in der romanisierten Version aus. Sprachen zu Romanisieren, ist der Versuch, sich ihnen mit seiner eigenen Sprache zu nähern – ehrenwert, aber oldschool und unnötig, wenn es eine offizielle Umschrift eines Landes gibt. Verwendet man dennoch die alte Fassung, bleibt ein kolonialer Beigeschmack übrig, weiter an Peking festhalten zu wollen. Deshalb möchte ich doch bitte dafür plädieren, Beijing statt Peking zu schreiben, zu sagen und zu denken – so wie bereits Guangzhou statt Kanton, Qingdao statt Tsingtao verwendet werden, Daoismus statt Taoismus, Konfuzius kann meinetwegen statt Kongzi in seinem alten Sud bleiben, bis er ehrlich reformiert wird. Auch PEK für den Flughafen wird nur noch von bzw. für Ausländern verwendet, in China heißt es BJS, Beijing shi, Beijing Stadt. Peking ist nicht nur die veraltete Version, sondern passt auch so gar nicht mehr zu dieser Stadt.
Und wer weiß, wie lange es Beijing überhaupt noch geben wird. Nach Xi Jinpings Verkündung von 2015 des städteplanerischen Großprojektes von Beijing hin zu Jingjinji, der Zusammenführung von Beijing, Tianjin und Hebei (nach dem Kfz-Kennzeichen Ji der ehemaligen Präfektur) zur Megametropolregion, kurz JJJ, bleibt hier seit Anfang 2017 kein Stein mehr auf dem anderen. Die Sehenswürdigkeiten dürfen bleiben, Touristen weiter kommen, ansonsten heißt es unter der Bevölkerung seither: Beijing soll verschwinden und nur noch Regierungssitz sein. Selbst die Vorzeigeuniversitäten Beida und Qinghua fangen fieberhaft an, sich um ihr Bleiberecht zu bemühen – wird schon, keiner glaubt an ihren Umzug, aber dass sie überhaupt aufjaulen müssen, alarmiert.
Gewähren wir der Stadt doch zumindest in ihren letzten Atemzügen noch ihren wirklichen Namen, bevor sie komplett zugemauert ist und ihre Bewohner zum Großteil vertrieben sind.

Tags für diesen Beitrag: Beijing 北京, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 28. August 2017
BJ: Kunsträume im Abrisssommer 2017
youjia, 17:25h

Überschattet ist dieses Jahr jegliche Hauptstadtaktivität von dem Wüten der Abrissbirnen. Aus dem Künstlerviertel Heiqiao zogen die letzten im Februar fort, Anfang August sieht es hier nun so aus. Die Gassen sind gerade noch erkennbar, aber außer Schutt und Steinen wurde jegliche Individualität dem Boden gleichgemacht.


Heiqiao, was eine glorreiche Zeit, nach einem Besuch im 798 und in Caochangdi konnte man hier in den Studios bei Freunden vorbei und sehen, was es Neues gab. Nun werden die Künstler immer weiter in die Außenbezirke verdrängt, weit verstreut mit Anreisen über eine Stunde, nach Luomahu oder, wie der Blackbridge Offspace 黑桥Off空间 nach Liqiao. Doch man gibt nicht auf, die Eröffnung zeigt Ende Juli den Umbau der Räume:




Schön ist es geworden. Doch dann, einen Monat nach Eröffnung, ein halbes Jahr nach Einzug, drehte der Vermieter Wasser und Strom ab – und wieder muss erneut gesucht werden, erneut renoviert, umgezogen, wieder mehr Miete gezahlt.
In der Innenstadt sieht es überall wüst aus, hier von West nach Ost durch den Fangjia hutong.




Das hier war einmal eine Abendschule.

Der ehemalige Eingang vom Hot Cat Club.

Verriegelung eines Kiosks.

Behelfsmäßig noch ein Einstieg.

El Nino noch mit Tischen draußen, serviert wird durch das Fenster.
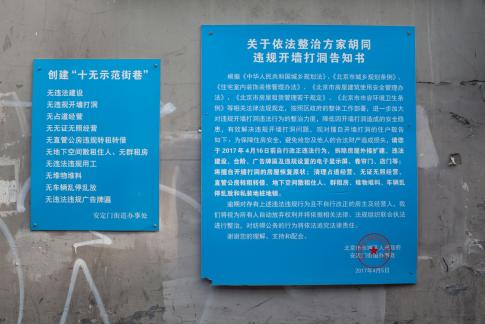
Mit Ansagen, gestempelt von der Dongcheng Regierung.

Wem das zu viel Text ist, der bekommt es daneben in einem Slogan in Weiß auf Rot: 坚决封堵开墙打洞 严厉打击违法建设 (Resolutes Verbarrikadieren, um die Mauern zu öffnen und den Vorschlaghammer zu schwingen, um die illegalen Konstruktionen mit einem Schlag abzureißen.) Die der Öffentlichkeit vorgesetzte Legitimation der „Aufräumaktion“ lautet, man entledige sich der „illegalen Konstruktionen“, das heißt all der Vorbauten, Lagerräumchen, der zusätzlichen Stockwerke, die tatsächlich meist selbst gezimmert sind. Doch nach welchen Stadtplänen vorgegangen wird, dem von 1949 etwa?, bleibt äußerst fraglich. Vor allem aber will die Zentralregierung bis 2020 die Bevölkerung Beijings auf 23 Millionen reduzieren. 40% der Ladenbesitzer sollen bereits aufgegeben haben und weggezogen sein (Straßenstand Ende August 2017).
Von all dem scheinbar unbeeindruckt und entsprechend beeindruckend, eröffnete Ende August ein neuer Space, Wyoming Project 怀俄明计划, zu finden Dongcheng District, Houyongkang hutong 12 北京市东城区后永康胡同12号. Für die erste Ausstellung warb man mit einem animierten Dildo, Chen Chenchen 陈陈陈: Possible Baby 可能宝宝, 20.8.–30.9.2017.

Neben einem Munitionsgürtel mit Minidildos gab es sonst hauptsächlich ein Ballerspiel, in dem man die Künstlerin aufsuchen und ermorden musste, dazu ein paar Fotografien und Malereien, auf dessen eventuell interessante Konzepte man aber wegen der wirren Optik doch keine rechte Lust hatte, sich einzulassen.

Eingang zum Space unter der blauweißen Markise. Nach der Eröffnung habe ich ihn trotz regelmäßigen Vorbeifahrens bislang allerdings nicht wieder geöffnet vorgefunden.
Ebenfalls Ende August eröffnete Lu Mei 卢玫 in Shunyi ihren Migrant Bird Space 候鸟空间 (aktuell VPN notwendig).



Derweil stellen sich Müllstationen außerhalb des 5. Rings auf, hier ein Beispiel aus dem Künstlerviertel Huantie. Man kann am Automaten per App kostenlos Sticker erhalten, für die momentane Testphase, wie es scheint, noch mit Personen bestückt, und seinen Müll mit diesen versehend zur Abholung einfach vor die Tür legen. Besonders freut mich, dass es endlich auch Schubladen für Batterien gibt. Es wirkt noch nicht ganz angenommen, aber mit vermutlich baldiger Verpflichtung und einhergehenden Bußgeldern kann man hier ja einiges erreichen.

Und der Abriss zieht sich weiter durch alle Ecken der Stadt.

Hier hinter dem Nationalmuseum. Noch gestützt von Eisenstangen, muss ihr einmal eine kleine Toilette angebaut gewesen sein.

Dazu sind überall in der Stadt Baustellen dieser Art für die Jingjinji-Schnellverbindungen zu sehen.

Im Jianchang hutong.

Detail. Alles geht grad grob und schnell, hier reicht für das ehemalige schmale Fenster eine Ziegelbreite.
Arrow Factory 箭厂空间 mauerte sich selbst zu und zeigt Yang Zhenzhong 杨振中: Fences 栅栏, 15.6.–30.8.2017 bzw. inzwischen verlängert bis … der Spuk vorbei ist?


Ums Eck dürfen die Tauben in der dritten Reihe zumindest momentan noch bleiben.
Tags für diesen Beitrag 这本文章的标签: Ausstellung 展览, Beijing 北京, Gegenwart 当代, Bildende Kunst 美术, Unterwegs 路上, Häufig gelesen 频看
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite